Schon das Dritte SMS von Armin, die Ansage mit jedem Mal dringlicher: «Wo bleibst du?», «Wann kommst du endlich?», «Wir warten ALLE auf dich!»
Sie fühlte sich von SMS zu SMS immer weniger angesprochen. «Mensch Lea…» begann das Vierte. Rasch wischte sie es weg. Einfach hier sitzen zwischen all diesen Büchern und book lovers, das war es, was sie wollte an diesem Nachmittag des 24. Dezembers.
Am Mittag war sie losgegangen, um rasch mal Wein und die letzten Geschenke zu kaufen. «Bin grad zurück», hatte sie zu Armin gesagt und ihn zwischen Tannenbäumchen und Weihnachtsschmuck stehen gelassen. Den Jungs hatte sie zugerufen «Helft Papa den Baum schmücken», dann warf sie die Wohnungstür hinter sich ins Schloss. Das war vor exakt drei Stunden, zwölf Minuten und «pling», inzwischen fünf SMS gewesen.
Zuvor war Armin mit den Einkäufen für Heiligabend nach Hause gekommen. Er hatte ihr eine Flasche Weisswein vor die Nase gestellt und gesagt: «Bio aus Chile, den wollte ich schon immer mal probieren, nimmt mich wunder, was der taugt.»
Sie musterte die Flasche, ein hässliches neon-grünes Etikett, dann ihren Mann.
«Das ist nicht dein Ernst, oder?»
«Doch, he du, nur drei Franken, und für das Fondue kommt es sowieso nicht so drauf an.»
Damit liess er sie stehen, um den Weihnachtsschmuck vom Estrich zu holen.
Es war ihm tatsächlich ernst. Das konnte doch nicht wahr sein, Wein aus Chile für ein Schweizer Käse Fondue. Bio hin oder her, aber das ging gar nicht. Auch zu argentinischem Rind wäre es für sie ein No-Go gewesen, und bisher hatte sie angenommen, dass auch ihr Mann so dachte. Wie konnte man Wein kaufen, der in Containerschiffen und mit Lastwagen über tausende von Kilometern herangekarrt wird? Noch nie hatten sie solche Weine gekauft. Warum ausgerechnet heute, an Weihnachten? Was war bloss in ihren Mann gefahren?
Wütend räumte sie die Einkäufe weg, die Flasche liess sie auf dem Tisch stehen. Als Armin, gelassen wie immer, in die Küche zurückkam, fauchte sie:
«Das glaub ich jetzt einfach nicht. Wie kannst du bloss Wein aus Chile kaufen, und dann noch für unser Weihnachts-Fondue?»
«Ich sag’s doch, ich will ihn probieren, ich will wissen, ob ein Wein für drei Franken etwas taugt.»
«Das interessiert mich nicht, das tut man einfach nicht, und so etwas haben wir bisher noch nie getan. Warum gerade heute? Ich verstehe dich nicht. Ich dachte, wir sind uns einig, dass wir keinen Wein aus Südafrika, Chile oder sonst von einem anderen Kontinent kaufen.»
«Jetzt sei doch nicht päpstlicher als der Papst. Die machen gute Weine, und eventuell ist es in Zukunft sogar ökologischer, wenn die sich auf Weinbau spezialisieren und wir es hier sein lassen damit, wie mit dem Fleisch. Die Ökobilanz von Weidefleisch aus Argentinien ist, trotz der grauen Transportenergie, immer noch um einiges positiver, als wenn wir die Viecher hier mit importiertem Kraftfutter durchfüttern.»
«Und was sollen dann unsere Bauern deiner Meinung nach in Zukunft tun?»
«Tja, weiss auch nicht, auf der Bank oder für eine Versicherung arbeiten?»
«Du hast sie wohl nicht alle. Mach doch mit deinem Wein, was du willst, ich geh einen anderen kaufen, der kommt mir nicht in mein Fondue.»
Damit hatte sie ihn stehen gelassen, um eben mal richtigen Fonduewein und letzte Weihnachtsgeschenke zu besorgen.
Das Velofahren tat ihr gut, der Wind um Nase und Ohren und die leise Konzentration auf den Verkehr entspannten sie. Schon beim COOP war ihr leichter ums Herz. Der Wein war rasch gekauft, ein Fendant. Nun noch in die Buchhandlung, die Bücher für die Jungs und Armin kaufen.
Sie schenkte immer Bücher zu Weihnachten, das hatte Tradition, und diesbezüglich war auf ihren Mann verlass. Er schenkte ihr auch Bücher, meistens waren diese ganz OK, doch manchmal griff er daneben.
Vor einem Jahr hatte er ihr dieses peinliche Malibu-Buch geschenkt. Was hatte er sich bloss dabei gedacht? Sie war doch keine, die seichte Romane las. Krimis ja, aber bitte keine Sentimentalitäten. Seither sprach sie öfters über ihre Lieblingsbücher und die gerade angesagten Autorinnen, die diesen oder jenen Preis gewonnen hätten. Bisher leider ohne Erfolg.
Und zum Geburtstag hatte er ihr ein Buch geschenkt, das sie schon hatte. Das hatte sie getroffen, beleidigt irgendwie. Hatte er den keine Augen im Kopf? Sie versteckte ihre Bücher doch nicht. Die Ungelesenen lagerten auf einem Stapel neben ihrem Bett und kamen erst nach dem Lesen ins Regal, ausser die, die sie kein Zweites Mal in die Hand nehmen würde, die kamen ins Brocki.
Schon war er wieder da, der Ärger. Auf dem Weg nach Örlikon trat sie kräftig in die Pedale. Seit ein paar Tagen plagte sie diese bange Vorahnung, es könnten die letzten Weihnachten sein, die sie gemeinsam als Familie verbrachten. Vielleicht, weil Ihr Ältester gerade zwanzig geworden war, und sie selbst in diesem Alter zu Hause ausgezogen war. Danach hatte sie keine einzige Nacht mehr bei ihren Eltern verbracht, nicht einmal als ihre Mutter im Sterben lag. Sie konnte einfach nicht.
Die Buchhandlung empfang sie mit einem wohligen Duft nach Zimt und Orangen, und da kam ihr das passende Buch für ihren Vegi-Sohn wieder in den Sinn: Simple von Ottolenghi. Für den Jüngeren, der neuerdings einen übertriebenen Hang zum Philosophieren hatte, wie sie fand, musste sie etwas länger stöbern. Doch nach ein paar Sätzen Lob der Erde von Byung-Chue Han lächelte sie zufrieden. Eine Philosophie der Langsamkeit und der exakten Beobachtung war genau das richtige für ihren Grübler. Sie ging zur Kasse und liess sich die beiden Bücher einpacken.
Sie war nie eine dieser überbehütenden Mütter gewesen. Selbstverständlich wollte auch sie nur das Beste für ihre Kinder, doch ihnen Vorschriften machen, was aus ihrem Leben werden sollte, das war nicht ihr Ding. Stattdessen liess sie sich lieber von ihren Ideen und von ihrer unbändigen Energie anstecken, und wusste schon jetzt, dass sie diese Kopfauffrischungen am meisten vermissen würde, wenn sie dereinst ausgezogen sein würden. Manchmal kam sie sich egoistisch vor, weil sie überzeugt war, dass ihre Jungs ihr viel mehr geben konnten als sie ihnen.
Mit Armin war sie die Familienplanung pragmatisch angegangen. Er verdiente gut und war bereit, sein Pensum zu reduzieren, damit sie nach den Schwangerschaften rasch wieder zurück an die Arbeit konnte. Ausserdem war er ordentlicher als sie, konnte gut kochen und war überhaupt recht fix im Haushalten. Mit der Zeit genoss sie es, nach getaner Arbeit nach Hause in eine aufgeräumte Wohnung zu kommen, in der es erst noch lecker nach Pasta oder Risotto duftete.
Für ihren Mann wollte sie wie immer einen Krimi kaufen, und zwar den Letzten von Camilleri, der erst kürzlich posthum erschienen war. Und einen historischen Roman, vielleicht Friedas Fall, den sie im Frühling im Kino gesehen hatte, oder war das eher etwas für Frauen? Ein Sachbuch auf jeden Fall. Etwas Anspruchsvolles konnte nie schaden. Zielstrebig steuerte sie auf die Ecke mit den Sachbüchern zu, und da sah sie ihn, von hinten und doch unverkennbar, Max.
Er trug seinen alten Lodenmantel, den er damals von seinem Vater geerbt hatte, als dieser überraschend gestorben war, und sie noch ein Paar waren. Sie hatten sich an der Uni kennengelernt und konnten unendlich über Bücher diskutieren, gnadenlos und leidenschaftlich.
Ihr Atem stockte, und das fahle Gefühl des Verlassenwerdens kehrte abrupt in ihren Bauch zurück, so als ob es nie weg gewesen wäre, bloss überdeckt von Ehe und Arbeit, aufgefüllt von zwei Schwangerschaften und begraben unter bestimmt mehr als tausend Büchern, die sie seit der Trennung verschlungen hatte. Und jetzt meldete sich ihr Körper und meinte doch tatsächlich, dass nichts von all dem, dieses unstillbare Loch, diese Lücke, die er vor einem Vierteljahrhundert in ihr hinterlassen hatte, zu schliessen vermocht hatte.
Sie atmete tief durch. Dann liess sie sich von der Buchhändlerin zwei Pappbecher mit Glühwein geben und peilte ihn an.
«Max, magst du mit mir auf uns anstossen?», sagte sie und wunderte sich kein bisschen über das «uns» in ihrer Frage.
 Tina Wodiunig, 1960*, lebt und arbeitet in Zürich. Während ihrem Ethnologie- und Sinologie-Studium lebte sie ein Jahr lang in China, danach begann sie in einem Museum zu arbeiten und absolvierte einen MAS in Museologie an der Uni Basel. Sie ist Mitglied der Autor*innen-Gruppe «Die aus Zürich». Derzeit arbeitet sie an einem Roman über ihre Grosstante, die in St. Gallen aufwuchs, nach Österreich ausgewiesen wurde und 1941 von den Nazis ermordet wurde.
Tina Wodiunig, 1960*, lebt und arbeitet in Zürich. Während ihrem Ethnologie- und Sinologie-Studium lebte sie ein Jahr lang in China, danach begann sie in einem Museum zu arbeiten und absolvierte einen MAS in Museologie an der Uni Basel. Sie ist Mitglied der Autor*innen-Gruppe «Die aus Zürich». Derzeit arbeitet sie an einem Roman über ihre Grosstante, die in St. Gallen aufwuchs, nach Österreich ausgewiesen wurde und 1941 von den Nazis ermordet wurde.
Adventsgeschichten 2024
Adventsgeschichten 2023
Adventsgeschichten 2022
Die Illustration von Lea Le ist ein Geschenk von literaturblatt.ch und der Künstlerin als Preis für einen der 7 ausgewählten Texte.




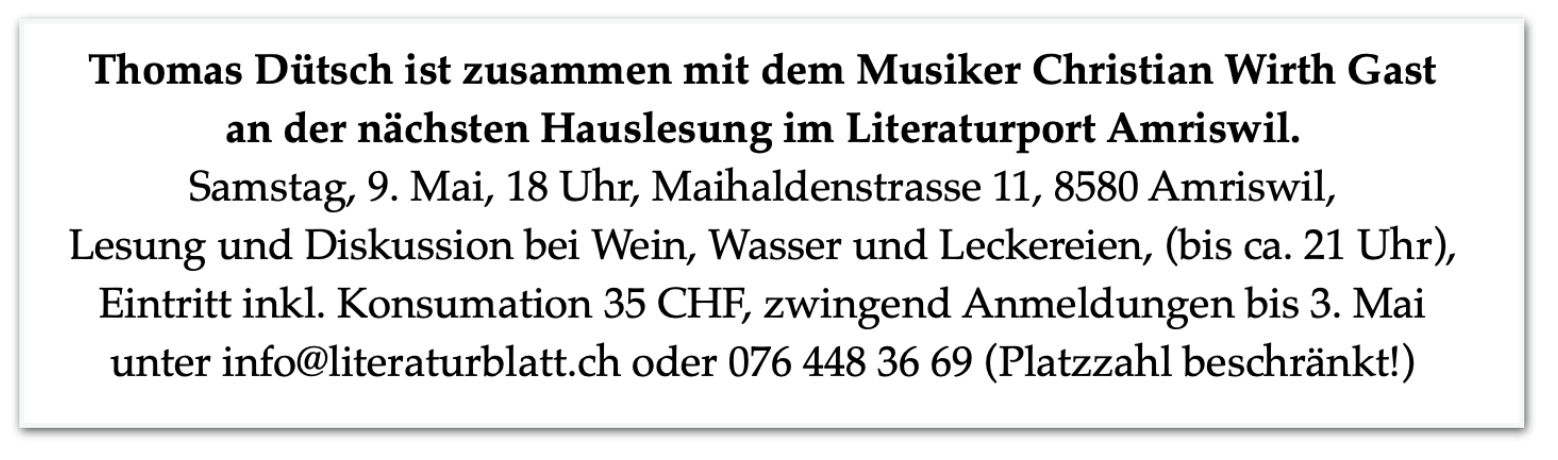
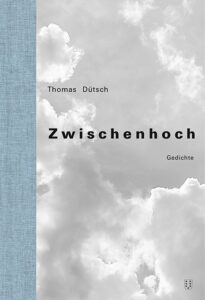


 Gabriela Cheng-Voser: In den letzten Monaten kämpfte ich mit einer Schreibblockade, so habe ich oft darüber nachgedacht, warum ich schreibe. Immerhin habe ich herausgefunden, dass ich mit meinen Texten Mitgefühl wecken möchte und dass mir die Menschen besonders am Herzen liegen, deren Ausgangslagen eher schwierig sind. Zudem habe ich eine Neigung zu Rollenprosa. „bittersüess“ ist der erste Text, den ich nach meinem Schreib-Stau für den Adventswettbewerb vom Literaturblatt eingereicht habe.
Gabriela Cheng-Voser: In den letzten Monaten kämpfte ich mit einer Schreibblockade, so habe ich oft darüber nachgedacht, warum ich schreibe. Immerhin habe ich herausgefunden, dass ich mit meinen Texten Mitgefühl wecken möchte und dass mir die Menschen besonders am Herzen liegen, deren Ausgangslagen eher schwierig sind. Zudem habe ich eine Neigung zu Rollenprosa. „bittersüess“ ist der erste Text, den ich nach meinem Schreib-Stau für den Adventswettbewerb vom Literaturblatt eingereicht habe.
 Béatrice Bader
Béatrice Bader
 Tina Wodiunig, 1960*, lebt und arbeitet in Zürich. Während ihrem Ethnologie- und Sinologie-Studium lebte sie ein Jahr lang in China, danach begann sie in einem Museum zu arbeiten und absolvierte einen MAS in Museologie an der Uni Basel. Sie ist Mitglied der Autor*innen-Gruppe «Die aus Zürich». Derzeit arbeitet sie an einem Roman über ihre Grosstante, die in St. Gallen aufwuchs, nach Österreich ausgewiesen wurde und 1941 von den Nazis ermordet wurde.
Tina Wodiunig, 1960*, lebt und arbeitet in Zürich. Während ihrem Ethnologie- und Sinologie-Studium lebte sie ein Jahr lang in China, danach begann sie in einem Museum zu arbeiten und absolvierte einen MAS in Museologie an der Uni Basel. Sie ist Mitglied der Autor*innen-Gruppe «Die aus Zürich». Derzeit arbeitet sie an einem Roman über ihre Grosstante, die in St. Gallen aufwuchs, nach Österreich ausgewiesen wurde und 1941 von den Nazis ermordet wurde.




 Gabriela Caponio, 1975, wohnt im Kanton Zürich. Sucht in Archiven nach Geschichten, besonders nach Kriminalfällen aus dem Zürich der 20er. Das Interesse gilt allgemein dem Proletariat und den Unterprivilegierten.
Gabriela Caponio, 1975, wohnt im Kanton Zürich. Sucht in Archiven nach Geschichten, besonders nach Kriminalfällen aus dem Zürich der 20er. Das Interesse gilt allgemein dem Proletariat und den Unterprivilegierten.