Im Laufe der Jahre wurde sein Sakko zur Beule. Sein Hut war ihm am Kopf angewachsen. Nur selten steckte in seinem Mundwinkel kein Krummer Hund. Seine Augen waren Knöpfe, denen keine Bewegung entging. Es lag wohl an seinem Schielen, daß sein Blick überall zugleich war. Seine Schuhe knarrten meine halbe Kindheit lang hinter meinem Rücken. Tagaus, tagein schlich er in Begleitung seines Krummen Hunds um den Bahnhof herum, redete mit niemandem, sah alles, während dem Krummen Hund darüber das Feuer ausging. Er sah mich durch den Maschendraht klettern und über die Gleise flitzen, sah mich am Bahnhofsbuffet zehn Mannerstollwerk zu einem Schilling kaufen (wenn ich den Schilling genau hatte, konnte mich die Frau am Buffet nicht betrügen), sah mich zurückflitzen über die Gleise und durch das Loch im Maschendraht verschwinden. Unser Haus lag nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt, was mich zum Bahnhofspezialisten machte. Ein Bahnhofspezialist ist zugleich einer für Abreisen und Ankommen, ein Sehnsuchtsspezialist.
Es mag an seinem Schielen gelegen haben, daß man meinen konnte, er starre einen an, egal wo man auch ging. Wenn ich über die Gleise flitzte sah er mich, wenn nicht er, dann doch sein Krummer Hund.
Es fuhren zwar nur selten Züge ein, aber die Sehnsucht schlief nie. Die Sehnsucht hauste am Bahnhof in Gestalt von einsamen Männern mit dunklen Augen, die als Schatten durch die Bahnhofshalle schlurften. Zwei oder drei von ihnen standen zusammen und sprachen eine rauhe erdige Sprache. In den im Rücken verschränkten Händen wanderten Gebetsketten.
In den Augen dieser Männer spiegelten sich einsame Ebenen unter sengender Sonne. Diese Männer standen anders beisammen. Ein Murmeln war da, ein stummes Zusammengehören, ein gemeinsam getragenes Leid. Diese Männer waren frei, sie hatten ihr fernes Anatolien hinter sich gelassen, doch die Freiheit war größer als sie. Sie gingen am Bahnhof schlurfend in Deckung.
Wie ein Trabant umkreiste sie der Mann mit den Knopfaugen, dessen Kopf immer schräg stand wie eine Tanne nach verheerendem Sturm. Hinkte er schon immer? Er war in seinen eigenen Schrittkreis eingeschlossen, den er unaufhörlich abschritt. Er war das Glotzermännle, so nannten wir ihn, er glotzte die Welt an, doch die Welt sah nicht zurück, sie übersah ihn, der hier auf dem schäbigen Bahnhof in Deckung ging. Er schritt seinen Kreis mit der verzweifelten Geduld eines Menschen ab, dessen Zeit in sich zusammengebrochen ist. Es hieß, er warte auf seinen Sohn, der aus dem Krieg nicht nach Hause gekommen war. Der Krieg, das war die gefrorene Zeit selbst, der Krieg am Ende der Zeit.
Sein Schritt grub sich mit jedem Jahr tiefer ein, er hinkte davon immer stärker. Das Knarren seiner Schuhe kündigte ihn an, er sagte kein Wort, niemand wußte, ob er sprechen konnte. Sein Blick war eng wie eine dunkle Röhre, aus der er nie mehr herausfinden würde.
Der Bahnhof war die Zone der Freiheit, die keiner ertrug. Von der Bahnhofstraße wehte es die Jahre heran, es trieb sie durch die gelbgekachelte Bahnhofshalle hindurch und hinaus auf die Gleise ins Nichts. Die Körper der Männer boten dem Wind keinen Widerstand, sie hatten ihr Leben irgendwo zurückgelassen, das nun ohne sie zurechtkommen mußte. Die Männer hatten ihre Gebetsketten, sie hatten ihre Erinnerung an eine sonnenverbrannte Steppe, und sie hatten die Körper der anderen, sie waren gemeinsam ein Körper der Sehnsucht und der Freiheit, die ein Stück zu groß für sie war. Irgendwann würde ein Zug sie von hier fort bringen, sie würden turmhoch beladen in ihr stilles Dorf zurückkehren, wohin sie nicht mehr gehörten, doch sie wären damit nicht allein, es würde andere geben, die ein ähnliches Schicksal hatten, die auf Arbeit in ein kaltes abweisendes Land gefahren waren, jung und ahnungslos, und deren Schläfen über der Nichtzugehörigkeit ergraut waren. Doch sie wären eine Gruppe, ihr Los hatte einen Namen, ihr Dorf hatte einen Namen, und es gab Vettern, Söhne und Frauen, die einen Namen trugen. Sie hätten die Kraft dem Bahnhof zu entkommen, denn sie kamen von irgendwo her, ihre Gedanken hatten ein Ziel, und was sie dachten bildete aus ihnen eine Gruppe. Ihre Frauen würden kommen, ihre Söhne würden ihre Rücken beim Gleisbau krümmen, und die Kraft ihrer Söhne würde sie mit Stolz erfüllen. Sie würden andere Männer treffen und Fotos tauschen, und mit Hilfe der Fotos würde ein Eheversprechen gegeben, junge Frauen würden kommen aus dem Dorf in der sonnenverbrannten Ebene. Die Kinder der Frauen auf den Fotos würden mit gelgestärktem Haar am Bahnhof Zigaretten kaufen, doch sie würden den Bahnhof nicht verstehen wie ihn ihre Väter verstanden. Sie würden den Gesang der Gleise nicht hören, denn sie hätten keine Zeit für die Leere und den Wind des Nichts, der über die Gleise weht.
Der hinkende Mann mit den Knopfaugen wurde schräg wie eine einsame verwitterte Tanne. Generationen von Fahrschülern stürmten johlend an ihm vorbei zu den Zügen. Wenn sie fort waren, wehte er noch, der Wind des Nichts. Auch die Unterführung konnte den Wind nicht vertreiben. Es wurde viel gebaut um den Bahnhof. Das alte Wirtshaus gegenüber, das kein Einheimischer mehr betrat, seit es den Männern mit den traurigen Augen gehörte, wich einer Wohnanlage. Die Bushaltestelle wurde zu einem Kompetenzzentrum für intelligente Verkehrsmittel. Man bemühte sich redlich, aus der Bahnhofstraße den Wind des Nichts zu vertreiben, umsonst. Der Wind der Leere weht zwischen den neuen Menschen hindurch, die dort gehen und nicht wissen, warum ihr Schuh nicht recht Boden findet. Selbst die Altdeutschen Stuben durften endlich verschwinden. Man versuchte mit intelligenter Architektur das Beste gegen den Wind der Leere. Aber der Wind kommt aus dem Innern der Jahre, er weht auch ohne daß ihn einer versteht.
Irgendwann haben die knarrenden Schuhe das Glotzermännle nicht mehr getragen. Irgendwann hat auch das Holz dieser Tanne nicht mehr gehalten. Keiner raucht am Bahnhof einen Krummen Hund. Keiner sieht alles und hält es zusammen, indem er es sieht. Es findet sich keiner mehr für diese Arbeit, von der keiner begreifen würde, daß es sie gibt. Man hat den Bahnhof umgebaut. Es gibt ein Servicecenter. Es gibt Bildschirme, die von ankommenden und abfahrenden Zügen berichten. Man hat die Bahnhofshalle gründlich gesäubert. Es ist kein Platz mehr für die Kollegen von der alkoholischen Flasche, die früher allen Platz für sich hatten. Sie haben es mit ihrem Gestank erledigt, ganz einfach. Wer mehr stinkt, der hat seinen Platz. Über dem modernen Polyester ist sogar den Flaschenmännern die Lust zu stinken vergangen. Von denen hat sich auch das Glotzermännle fern gehalten. Die bildeten eine eigene grausame Welt, unberührt von den anderen. Die Männer mit den Gebetsketten hatten eine traurige Würde. Sie tranken nie. Sie murmelten. Ihre Augen sprachen. Und sie hatten eine Heimat, wenn es auch nur eine verbrannte Sonne war. Die Flaschenmänner hatten nichts als gemeinsames Geschrei aus violettgesoffenen Gesichtern. Und sie zelebrierten ihren Gestank als ihr höchstes Gut. Ihr Gestank war ihre Waffe.
Der hinkende Mann ohne Sprache hatte seinen eigenen Kreis, der sich durch die Jahre drehte. Dieser Kreis hatte keinen Grund und kein Gedächtnis. Er hatte vergessen, weshalb er sich drehte. Er hatte keinen Anteil an der Freiheit der Gleise, sein Leben war klein, es bestand aus Schritten, deren Sinn irgendwo da draußen in der Welt verloren gegangen war.
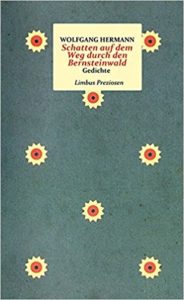 Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem „Abschied ohne Ende“ (2012), „Die Kunst des unterirdischen Fliegens“ (2015) und „Herr Faustini bleibt zu Hause“ (2016). Bei Limbus: „Paris Berlin New York“ (erstmals erschienen 1992, Neuauflage 2008, als Limbus Preziose 2015), „Konstruktion einer Stadt“ (2009) und „Die letzten Gesänge“ (2015).
Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem „Abschied ohne Ende“ (2012), „Die Kunst des unterirdischen Fliegens“ (2015) und „Herr Faustini bleibt zu Hause“ (2016). Bei Limbus: „Paris Berlin New York“ (erstmals erschienen 1992, Neuauflage 2008, als Limbus Preziose 2015), „Konstruktion einer Stadt“ (2009) und „Die letzten Gesänge“ (2015).
Rezension zum Gedichtband «Schatten auf dem Weg durch den Bernsteinwald» auf literaturblatt.ch
