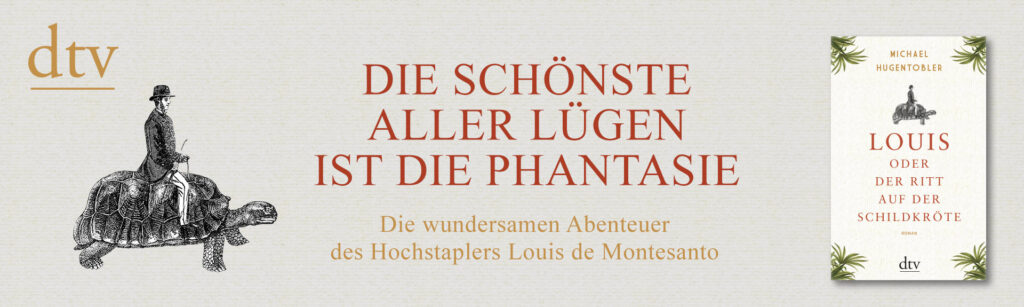Ein niederer Beamter der argentinischen Grenzbehörde absolvierte im Dezember 1945 seinen ersten Arbeitstag in Ushuaia, als die SS Lugano anlegte, ein Passagierschiff aus Genua. So wird es erzählt. Der Grenzbeamte sah einen kahlen alten Mann, der das Schiff als erster verliess, wie er die Zugangsbrücke herunter kam, mit der Körperhaltung eines Greises und dem Schritttempo eines Läufers.
Während des Krieges hatte der Beamte am Hafen von Buenos Aires die Flut von Migranten bewältigt, die vor dem flammenden Europa geflüchtet waren. Er war es sich gewöhnt, in wirre Augen zu schauen und seltsame Antworten zu bekommen, und so dachte er sich nun wenig dabei, als er auf die Frage, was der alte Mann hier am Ende der Welt zu finden hoffe, zu hören bekam: „Das Paradies!“
Ein jüngerer Grenzbeamter mit weniger Erfahrung hätte vielleicht seinen Vorgesetzten gerufen und die Vermutung geäussert, bei diesem Herrn könnte es sich um einen Fall für zusätzliche Abklärungen handeln – allein die Tatsache, dass der Alte ausser einer zerschrundenen Ledertasche kein Gepäck hatte, dass er in unglaublicher Eile zu sein schien, und dass seine rechte Hand eine einzige Eiterbeule war, eine grotesk deformierte Keule so dick wie ein Oberschenkel, umwickelt mit einer fleckigen Mullbinde, aus der eine gallertartige Masse tropfte, gelb wie Quittengelee – aber auch dann wäre der Herr wohl früher oder später durchgewinkt worden, da es von dieser Sorte nun mal ziemlich viele gab. Zudem erschien dem Grenzbeamten die Aussage, hier liege das Paradies, keineswegs verfehlt, hatte er doch die vergangenen zwei Wochen vor seinem Arbeitsantritt auf langen Wanderungen die Kiefernwälder bewundert, die von türkisfarbenen Bächen durchschnitten wurden und sich ab der stoische Ruhe der Bewohner erfreut, die nur sprachen, wenn es wirklich etwas zu sagen gab.
Dennoch, aus reiner Neugierde, entschied sich der Grenzbeamte dazu, den Alten etwas näher auszufragen: Was es denn mit dem vermeintlichen Paradies auf sich habe?
Er kenne, sagte der Mann, diesen Flecken Erde wie seine eigene Hosentasche, das Wiegen der Scheinkiefern im Wind, den Ruf des Guanakos in der Nacht, den Geruch der Mähnenrobbe und des Seebären und des Otters, das Geräusch des Stachelbeerbusches in der klirrenden Kälte, er sei hier sozusagen zum Mann herangewachsen. Und dann tippte er mit dem ausgestreckten Zeigefinger Bergspitzen ab und sprach Namen aus, allerdings in einer Sprache, die der Grenzbeamte nicht verstand.
So kam es, dass das Visum dieses alten Deutschen im Bruchteil einer Sekunde abgestempelt wurde. Anschliessend zog der Grenzbeamte den Reissverschluss der abgewetzten Rindsledertasche zurück und fand dort einen lila Stofffetzen, von dem er im ersten Moment dachte, es sei ein alter Putzlappen. Dann aber fielen ihm die verblassten Drucke der rosaroten Chrysanthemen auf, und die ausgefransten türkisfarbenen Kontrastpaspeln am Revers, und er fragte den Deutschen, was das denn sei, und der Mann murmelte etwas von einem Pyjama und etwas von einer verstorbenen Ehefrau.
Peinlich berührt winkte der Grenzbeamte den Deutschen durch, anschliessend prüfte er die Papiere eines einarmigen Schafhirten, eines blinden Schuhmachers, und schliesslich einer Familie aus Hamburg, die ihm etwas suspekt vorkam, zumal diese Leute normalerweise per Flugzeug ins Land kamen. Zwei Mädchen mit blonden Zöpfen lächelten. Der Mann sagte, er sei Steuerverwalter, was der argentinische Beamte sofort glaubte, die Frau sagte, sie sei Hausfrau, was der Beamte ebenfalls glaubte, und dann blätterte er durch die ganzen Empfehlungsschreiben aus der Schweiz, fragte sich kurz, wozu ein deutscher Steuerverwalter solche Dokumente brauche, prüfte dann eingehend die Stempel und die Siegel und musste schliesslich einsehen, dass sich sämtliche Fragen erübrigten.
Nach der biederen Familie aber kam ihm plötzlich nochmals der alte Deutsche mit der triefenden Hand in den Sinn, er schüttelte den Kopf, zog den Rollo vor seinem Schalter, bückte sich und entnahm der Tasche zwischen seinen Füssen ein Wachspapier und eine Thermoskanne. Er wickelte eine Empanada aus dem Papier, goss sich eine Tasse Kaffee ein und verliess das Gebäude durch den Hinterausgang.
Es war ein ausgesprochen nasser und kalter Dezember, und obschon dies der südamerikanische Sommer war, war das Thermometer tagsüber nie auf über sechs bis sieben Grad geklettert, und in zwei Nächten hatte es geschneit. Der Beamte schlüpfte in seine Drillichjacke, ging um das Gebäude herum, setzte sich an der Vorderseite auf eine Bank, nippte an der dampfenden Tasse, zerbiss die knusprig gebackene Kruste der Empanada und schmeckte auf der Zunge salziges Fleisch und Kreuzkümmel. Vorne auf der Strasse sah er den alten Deutschen, in seinem zerschlissenen Gelehrtenjackett, seinen ausgefransten Bundfaltenhosen, seinen flappenden Schuhen, wie er im Laufschritt an den Barackenhäusern mit ihren Wellblechdächern vorbeiging, weiter den Hügel hoch, am Gefängnis vorbei, das wie eine Spinne mit ausgestreckten Beinen dalag.
Der Deutsche hatte den Rand der Siedlung hinter sich gelassen, als sich die Wolken am Himmel zu Türmen ballten, bald würde er die Wälder erreichen, die sich bis zum Fuss der Berge hinziehen, und die nun mit Schnee bedeckt waren, und dahinter würde sehr lange nichts mehr kommen, keine Siedlung, keine Farm, rein gar nichts ausser Wildnis, und vermutlich würde der Deutsche bald einen Wintermantel brauchen, respektive eine ganze Ausrüstung zum Überleben in der unberechenbaren Natur, Handschuhe, Stiefel, wollene Unterwäsche, Fellmütze, viele Dinge, von denen er kein einziges besass.
Der Grenzbeamte nahm das Fernglas hervor, das er am Gurt trug, und nun sah er den Mann, als stünde er nur wenige Meter hinter ihm. Er sah den kahlen Kopf und den faltigen Nacken, er sah die losen Nähte des Jacketts und den von Schweiss verfärbten Hemdkragen. Und er sah eine Wand aus Nebel und Schnee, die herannahte.
In diesem Moment drehte sich der alte Deutsche ganz langsam um. Eine Atemwolke drang aus seinem Mund und verflüchtigte sich sofort in der eisigen Luft. Er schien nicht zu bemerken, dass er beobachtet wurde, oder vielleicht kümmerte es ihn auch nicht, er richtete einen tränenden Blick auf einen unsichtbaren Punkt, auf diese oder jene Bergspitze, oder vielleicht auch auf eine Wolke. Dann schloss er die Augen, die Züge vollkommen entspannt, wie ein Mönch, versunken in einen Zustand der Ruhe und des Friedens.
Der Beamte würde an diesem Abend in seinen Tagesrapport schreiben, es sei ihm unerklärlich, wie eine derart verwahrloste Erscheinung ein solch unbeschreibliches Glück ausstrahlen könne, der Krieg möge dazu beigetragen haben, oder vielleicht sei der Mann auch schlicht und einfach verrückt gewesen.
Im nächsten Moment wurde der alte Deutsche von einem weissen Schleier geschluckt.
So wird es erzählt, in der patagonischen Nacht, wenn der Wind aus unerklärlichen Gründen zu pfeifen beginnt, und dieser Wind etwas sagen will, vielleicht sagt er sogar etwas, aber man versteht es nicht, oder will es nicht verstehen. Der argentinische Grenzbeamte legte sein Fernglas nieder, griff zu seiner Kaffeetasse und nahm einen Schluck. Ein Schauder durchzuckte ihn, vielleicht war der Kaffee kalt geworden. Er ging zurück ins Haus, setzte sich auf seinen Hocker und liess den Rollo hochschnellen.
Er hatte einen Menschen sterben gesehen. Aber das wusste er nicht. Nein, er wusste es nicht.
Michael Hugentoblers neuer Roman «Feuerland» erscheint bei dtv Ende März 2021: Thomas Bridges wächst als Ziehsohn eines britischen Missionars am südlichen Ende Südamerikas auf, unter den Kindern der Yamana. Fasziniert von der reichen Welt und Sprache dieses Volkes, beginnt er, obsessiv ihre Wörter aufzuschreiben. Diese wertvolle Sammlung, sein Buch, wird ihm Jahrzehnte später gestohlen und fällt dem deutschen Völkerkundler Ferdinand Hestermann in die Hände. Hestermann spürt, dass er es mit einem einmaligen Schatz zu tun hat. Er verschreibt ihm sein Leben. Als in den 1930er Jahren die Nationalsozialisten beginnen, Bibliotheken zu plündern, begibt er sich auf eine gefährliche Reise, um das Buch in Sicherheit zu bringen.
Im September 2021 ist der Autor Gast im Literaturhaus Thurgau.
 Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» (2018) ist sein erster Roman.
Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» (2018) ist sein erster Roman.
Beitragsbild © Dominic Nahr