Claudia war ein Anker für mich in der Welt. Sie hatte keine andere Wahl, denn ich wusste nichts, woran ich mich sonst hätte festhalten sollen. Sie lachte laut und viel und fiel manchmal vom Stuhl davon, rappelte sich aber wieder auf und ab und zu bestellte sie im selben Atemzug ein Bier, von dem sie dann behauptete, vom ersten bis zum letzten Schluck, es schmecke scheusslich.
Claudia war lang und schön und schielte meist in sich hinein, während sie sprach. Ich dachte oft, ich könnte mitschielen, aber ich konnte es nicht. Bestimmt hatte sie irgendwo Wurzeln geschlagen, tief unten im Meer, das grün in ihren Augen schwappte, als wäre sie gewohnt unter Wasser zu sehen. Sie war die meiner Schwerkraft entgegengesetzte Energie. Und ich fürchtete den Moment, in dem ich ihr zuviel werden würde, zu nah und zu schwer als dass ihr Auftrieb für uns beide reichte. Doch sie trug mich. Lachte mich so lange aus, bis die Schwerigkeit verschwunden war und ich selber lachen konnte.
Ich wollte immer bei ihr sein, oder genauer, wollte, dass sie immer bei mir war, denn ich konnte die Kälte schlecht aushalten und Claudi sass meistens irgendwo im Freien auf einer Bank oder einer Mauer und atmete, als wolle sie die ganze Welt einsaugen, was nicht geschah. Ich hoffte es aber, hoffte, sie würde mich eines Tages mit einatmen, damit ich in ihr fortdauern und durch ihre Meeraugen sehen könnte. Ich wollte von ihr gelacht und durch die Welt getragen werden. Aber Claudia atmete mich nicht ein, behauptete überdies, dass das gar nicht möglich sei.
Eine Liebeserklärung brauchte sie nicht, denn ich lag offen da, das war Erklärung genug. Für Claudi war ich überschaubar. Ich hielt mich an ihrer Hand und versuchte, dies möglichst unauffällig zu tun, um nicht zu klammern, wenn die Wellen hoch schlugen und auch sonst. Woher sie ihre Sicherheit nahm, wusste ich nie, es schien, sie stelle einfach ihre Füsse auf den Boden und trage den Kopf auf den Schultern. Sie liess sich dabei selten etwas anmerken. Claudia stellte fest. Ich sage, wie es ist, sagte sie.
Ich liebte sie mit unbestimmter Heftigkeit, denn sie war meine Freundin. Wir stahlen zwar keine Pferde aber Gemüse, Bücher, Schlafsäcke und einmal ein Boot, mit dem wir uns auf dem See davontreiben liessen bis zum Morgen.
Und dann war sie weg. Fast kommentarlos. Sie packte ein paar Kleider in einen alten Rucksack und verreiste und mich nahm sie nicht mit. In meinem Herzen schon, sagte sie. Aber das klang mir nach Spott. Es war klar ersichtlich, dass sie mich nicht mitnahm. Aus ihren Briefen rieselte Sand und sie beschrieb mit pedantischer Genauigkeit Dünen, Klippen, Wolken und das Meer, schrieb aber nie, wo sie sich aufhielt. Ich sagte, das kann mir egal sein. Ich sagte, es ist mir egal. Ich versuchte vergeblich, sie zu vergessen, sass zuhause am Fenster und hielt Ausschau, rieb mich an der Unantastbarkeit der Landschaft ohne sie.
Ich trieb in einer uferlosen Trübsal herum und fand keine seichte Stelle, an der ich ihr hätte entsteigen können. Ich wurde abwechselnd böse und reumütig, schrie, wartete, und kotzte, während ich sie herbeisehnte. Irgendwann wusste ich, dass sie nicht wiederkommen würde, weil zu viel Zeit vergangen war, zu viel Sand und Welt gibt es an den Rändern des Meeres, warum hätte sie genau zu mir zurückkehren sollen? Ich verurteilte Claudi in absentia, ihrer Treulosigkeit wegen, und kesselte sie in der Trockenheit meines Herzens ein, dort sollte sie bleiben, beschloss ich.
Als sie plötzlich vor meiner Tür stand, wünschte ich mir, sie nicht erkennen zu können, aber es half nichts. Ich trat zur Seite und bat Claudia herein, fragte, wie es ihr gehe; und sie sagte, dass sie nicht hätte gehen müssen. Sie wolle da nicht weiter drüber reden. Also hielt ich nur ihre Hand, während sie nach draussen starrte. Der Tee wurde in ihrer Tasse kalt, immer bevor sie ihn trinken konnte, sie blies hinein, ich wusste nicht wieso. Traute mich nicht, Claudi zu fragen. Sie schaute trüb aus, zauderte und war beständig müde. Sie hatte sich in Zweifel gezogen, aber nicht wieder heraus. Sogar ich begann sie zu bezweifeln. Sie war kein Anker mehr, sondern ein Boot, in dem wir nicht beide Platz fanden, sie schlingerte auf hoher See.
Ich verstand, dass es nun an mir lag, dass ich ihr Anlaufstelle zu sein vermögen sollte, aber sonst verstand ich nichts. Ich wollte, dass sie etwas benannte. Wollte, dass es da etwas gab, etwas möglichst Grosses, das man benennen und sich danach von ihm abwenden konnte. Einfach umdrehen und davonlaufen. Etwas worauf sich Staub sammelt und das man schliesslich ganz vergisst. Aber es gab nichts. Ich hielt ausufernde Reden, um sie aufzumuntern und selbst die Stille nicht ertragen zu müssen. Manchmal lachte sie leise, als schäme sie sich, dann wollte ich weinen, aber das kam mir fehl am Platz vor. Ich hätte gern, so als wäre nichts dabei, meine Füße auf den Boden gestellt und Claudi auf meinen Schultern getragen, aber ich war zu hager und sie zu groß dafür und ich wusste nicht, wie es geht. Also ließ ich alles sein, wie es war. Claudi blieb bei mir und ich hielt ihre kühle Hand, so gut es ging, wir schauten aus dem Fenster und waren ein wenig verloren.
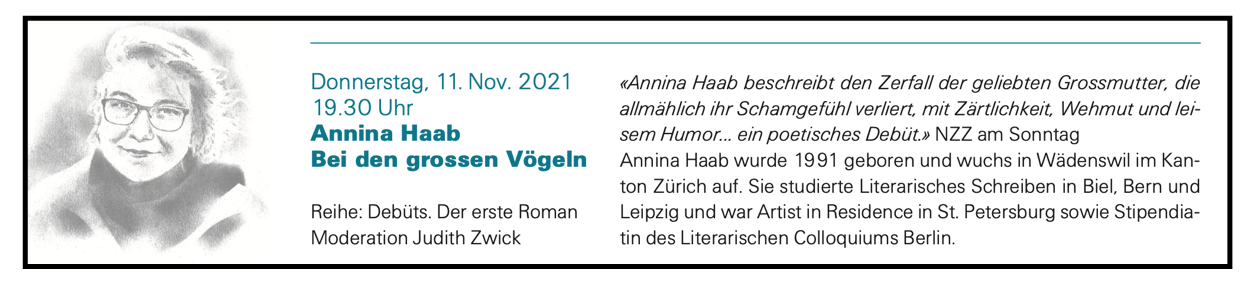
Annina Haab wurde 1991 geboren und wuchs in Wädenswil im Kanton Zürich auf. Sie studierte Literarisches Schreiben in Biel, Bern und Leipzig und war Artist in Residence am Zentrum für nonkonformistische Kunst St. Petersburg sowie Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Colloquiums Berlin. Heute lebt Annina Haab in Basel. «Bei den großen Vögeln» ist ihr erster Roman.
Rezension von «Bei den großen Vögeln» auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © leafrei.com / Literaturhaus Thurgau
