Heute vor genau dreissig Jahren und während ich in einer Lektion der Arabischen Sprache den Aufbau eines Satzes an der Wandtafel grammatikalisch erklärte, stürzte plötzlich der Lehrer des Fachs Militärisches ins Klassenzimmer. Er rief schreiend meinen Namen: „Al-Jamous, folge mir sofort, damit wir herausfinden können, wer der Täter ist und wer das Opfer!“ Hätte er den Boden unter meinen Füssen nicht schreiend zum Beben gebracht, hätte ich gedacht, er wäre gekommen, um anstatt meiner Selbst den Satz grammatikalisch auseinanderzunehmen. Doch er zeigte mit dem Finger verächtlich auf mich: ich müsste sofort das Klassenzimmer verlassen. Die Lehrerin für Arabische Sprache unternahm nichts dagegen, ja, sie traute sich nicht mal, nach dem Grund zu fragen. Als ich sie fragend anschaute, wurde mir klar, dass sie von mir nichts anderes erwartete, als den militärisch schreienden Lehrer zu begleiten. Sie sprach kein Wort, ihre strengen Augen jedoch rieten mir, seinen Befehl widerstandslos zu befolgen. Was ich auch auf der Stelle tat.
Ich erinnere mich gut daran, wie er mir befohlen hat, ihm zu folgen und als er die Türe hinter sich zugeschlagen hatte, stiess er mich mit seiner Hand, mit der Absicht, mich zu erniedrigen. Seine verachtenden Worte schlugen wie Blitz und Donner auf meinen Kopf und auf meine Ohren herab. Meine Tränen brachen hervor wie ein Platzregen. „Warum erniedrigen Sie mich so?“, fragte ich ihn weinend. Mein kindliches Auffassungsvermögen konnte seine wütende Antwort kaum erfassen: „Wie kannst du eine solche Frechheit haben, sowas zu fragen?!“ Seiner Auffassung nach hatte ich nicht das Recht, ihn zu fragen, denn was ich „getan“ hatte, war in seinen Augen selbstverständlich ein Verbrechen und darum dürfte ich keine Fragen stellen. Ein weiteres Mal stiess er mich, und zwar auf der Treppe vom zweiten in den ersten Stock. Ich hatte das Glück, das Geländer im letzten Moment beidhändig gefasst zu haben, bevor ich fallen konnte. Für einen Moment konnte ich stehen bleiben. Dann zog er mich an meinen militärischen Kleidern in Richtung des Büros des Schuldirektors. Unglücklicherweise war der meiner Meinung nach offenherzige Direktor nicht anwesend. Ahmad – so hiess der Militärlehrer – öffnete die Türe und stiess mich ein weiteres Mal, so dass ich vorausfiel – direkt vor den Militärrat.
Der Rat bestand aus drei Mitgliedern: Ahmad selbst, der für das Fach Militärisches zuständig war und dessen Name sowie dessen Aussehen ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde; Samira, die Schulsekretärin, die für unsere Schülerdokumentation zuständig war; und Ahmad, der Mathelehrer. Der Letztere verbrachte gerade seine Pause damit, mir zuzusehen, wie ich fast hingerichtet werden sollte. Ich hob meinen Kopf und fragte: „Was soll das alles?“ Ich fragte aber nicht danach, was ich denn getan hätte – ich hatte mir ja nichts zuschulden kommen lassen. „Warum all diese Gewalt?“, fragte ich erneut.
«Wie erlaubst du dir da sowas zu fragen?» antwortete Samira, während sie den Fuss nervös rauf und runter bewegte. In ihrer Hand hielt sie einen Olivenzweig, mit dem sie immer mal wieder Kinder zu schlagen pflegte, die sich nicht rechtzeitig im Schulhof zum militärischen Gruss an Al-Asad einfanden. Die ganze Schule musste dort jeden Morgen mit voller und einiger Stimme „Asad Qa‘iduna ila al-Abad“ – „Asad ist unser Führer bis in alle Ewigkeit“, rufen. Unsere Kinderstimmen waren ständig von den Worten „Asad“ und „Abad“ beherrscht und unser Bewegungsapparat war ebenfalls ständig beherrscht vom militärischen Armhervorstrecken in Richtung des mannigfaltigen Konterfeis des Führers, der in der Schule allgegenwärtig war. Eigentlich sahen wir nicht viel anders aus als die Hitlerjugend. Mit jenem Olivenzweig hatten meine beiden Hände sehr viel Erfahrung, denn Asad war für mich kein einziger Tag lang mein Führer.
„Mit welcher Frechheit wagst du es, uns anzuschauen und zu fragen? Gewalt? Von welcher Gewalt sprichst du!?“ Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was du verdienst. Dein Vater und deine Brüder werden dich heute noch auspeitschen, schlagen und einsperren und sie werden eilends diese Schande wieder wettmachen, indem sie dich verheiraten. Du bist sehr frech“, fügte die Lehrerin noch hinzu und sie labte sich daran, wie sie meine Seele ohrfeigte.
„Schande? Von welcher Schande sprechen Sie, Frau Lehrerin?“, fragte ich sie. Ahmad, der Vorsteher des Militärrates, schrie: „Bist du in die Schule gekommen, um hier zu lieben und unmoralische Beziehungen einzugehen!? Du bist so unverschämt!“ Als ich gerade etwas sagen wollte und meinen Mund öffnete, begann anstelle der anderen der Mathematiklehrer, mich zu piesacken und mich niederzumachen. Sie wiederholten: „Wir werden es deinem Vater und deinen sechs Brüdern sagen; der jüngste und der älteste Bruder werden sich dabei abwechseln, dich zu schlagen.“ Also schrie ich ihnen zu: „Macht schnell und ruft sie an, damit mein Leiden bald ein Ende findet!“
Ein Satz durchbohrt mein Gedächtnis
Die Lehrerin sagte: “Natürlich werde ich anrufen, damit ich die Möglichkeit bekomme, zu sehen, wie deine Nase in den Dreck gedrückt wird und nichts wird deine Sünde wegwaschen ausser der Geruch von Blut.” Ich werde ihr Gesicht nie vergessen, als sie diesen Satz sagte, diesen Satz, der sich mir ins Gedächtnis brannte. Sie sagte dies, währendem sie ihre Zähne zusammenbiss wie eine Hyäne.
Samira die Hyäne fauchte ins Telefon und wies meinen Vater an, er solle sofort in die Schule kommen, ohne ihm zu sagen, warum es ging, aber das es sehr eilig wäre. Diese halbe Stunde, die mein Vater brauchte, um zur Schule zu gelangen, kam mir vor wie ein ganzes Jahr. Ahmad der Lehrer schwieg während dieses Jahres keinesfalls, und seine Worte waren schrecklicher als je zuvor. Seine Worte waren wie Steine, die von allen Seiten auf mich hereinprasselten. Schliesslich kam mein Vater zum Militärrat und ich war dort, die kleine Soldatin, die an der Guillotine kniete. Mein Vater eilte zu mir, hob mich hoch, drückte mich an seine Brust, küsste mich auf den Kopf und fragte die anderen wütend: „Warum kniet meine Tochter auf dem Boden!? Ich will sofort eine Antwort!“
Da sagte ihm Samira: “Wenn Sie wüssten, was sie gemacht hat, dann würden Sie sie ohrfeigen, anstatt sie zu drücken und zu küssen.”
„Warum kniet meine Tochter auf dem Boden!?“, schrie mein Vater in ihr Gesicht.
Die Lehrerin beeilte sich, meinem Vater ihr Gift ins Gesicht zu speien und sagte: “Wir fingen einen Liebesbrief ab, der für Ihre Tochter bestimmt war.“ Mein Vater sah mich an und küsste mich noch einmal auf den Kopf. Dies überraschte die Schlange und sie sagte: „Aber ich sagte Ihnen: Wir haben einen Liebesbrief gefunden!“, und sie schaute zum Lehrer des Militärischen, sodass er sprechen sollte. Dieser zog seine Uniform zurecht, holte tief Luft, zog einen Brief aus seiner Hosentasche und sagte: „Als ich der neunten Klasse gerade beibrachte, wie man die Kalaschnikow auseinandernimmt und wieder zusammensetzt, sah ich einen Schüler, wie er einer Mitschülerin diesen Brief zusteckte. Ich riss den Brief aus ihrer Hand, las ihn und es wurde unmissverständlich klar, dass dies ein Liebesbrief war, der an ihre Tochter gerichtet war. Ein Liebesbrief in diesem Alter bedeutet, dass sie in Zukunft unzüchtige Taten begehen wird. So brachte ich Ihre Tochter hierher, da es unsere aller Pflicht ist, Sie davon zu unterrichten, damit Sie diese Schande tilgen.“
Mein Vater nahm einen tiefen Atemzug und schrie in sein Gesicht: „Sie sind derjenige, der die Schande wiedergutmachen muss, Sie Idiot!“
„Ich!? Es ist nicht meine Tochter, die lebendig begraben werden müsste!“, sagte Ahmad der Lehrer.
„Sie sind derjenige, der jemanden lebendig begraben sollte, und zwar sich selbst, Sie Idiot! Geben Sie ihr sofort den Brief!“, befahl mein Vater und zeigte auf mich. „Lies laut vor!“
Ich nahm den Brief entgegen und öffnete ihn und er verströmte sogleich einen zauberhaften Duft. Dies war der erste Brief, den ich von einem Militär anstelle eines Postmanns erhielt. Ahmad der Militärlehrer warf mir Blicke zu wie Kugeln aus Blei und Ahmad der Mathematiklehrer zählte meine letzten Atemzüge und berechnete, wie viele Minuten mir bleiben würden, bis ich diesen Militärrat für immer verlassen und sterben müsste. Ich sah Samira an, die meine Kindheit vergiftet hatte, und begann damit, den ersten Satz zu lesen.
Zaher, mein Schatz حبيبتي زهر
Mein Schatz, ich möchte so gerne dein Herz gewinnen. Seit ich dich zum ersten Mal sah, schlägt mein Herz im Rhythmus deines Namens. Was für ein Glück es ist, deinen Namen aussprechen zu dürfen. Dein Name allein bedeutet Glück. Wie gross doch mein Glück ist. Jeden Morgen versuche ich, dir ‚Guten Morgen‘ zu wünschen, wenn du wie eine Wolke an mir vorbeiziehst. Aber ich stottere, und in meinem Herzen regnet es Traurigkeit. Erneut versuche ich jeweils am Ende des Tages dir bis zur Tür deines Hauses zu folgen, um dir ‚Tschüss‘ zu sagen, aber ich stottere erneut. Jede Nacht versuche ich, mutig zu sein, denn deine Liebe sehnt sich nach einem mutigen jungen Mann. In meinen Träumen habe ich ein Treffen mit dir und flüstere dir Worte der Liebe in dein Ohr. Ich frage mich, wie oft ich dir noch morgens sagen werde, dass ich dich liebe, und wie oft ich dir noch sagen werde, dass ich dich abends vermisse. Ich werde zu dir segeln, währendem sich um mich herum Haie tummeln. Ich weiss, dass der Sturm gegen mein Schiff branden wird, aber ich werde das Ruder auf Kurs halten. Ein Tagtraum sagt mir, dass du als Meerjungfrau am Strand auf mich warten wirst. Ich werde als Prinz anlanden und eine Perlenkrone tragen. Mein Schatz, eile nicht, sodass du deine süsse Stimme nicht an eine der Seeschlangen verlierst. Ich wählte deine Liebe, denn deine Liebe funkelt so schön zwischen den Korallen und den Austern. Nimm meine Hand und tauche mit mir hinab – ich schenke meine Seele dem Wächter des Strandes.
Ich liebe dich, mein Mädchen.
Zahir زاهر
Es herrschte eine Todesstille im Exekutionssaal, jeder sah ins finstere Gesicht des Anderen. Da brach mein Vater die Stille und bat den Militärlehrer, den Zahir zu holen, und zwar ohne ihm weh zu tun, so wie er es mit mir gemacht hatte.
Zahir wurde hereingebracht, zitternd, mit gerötetem Gesicht und schwitzend. Wir wussten nicht, ob Ahmad der Lehrer Zahir beleidigt hatte, bevor er ihn ins Zimmer brachte. Aber er war offensichtlich verängstigt.
Mein Vater fragte ihn: “Hast du diesen Brief geschrieben?” Zahir antwortete nicht, denn er war sich nicht sicher, was da auf ihn zukommen würde. Mein Vater klopfte ihm auf die Schulter und sagte: „Du hast im Brief geschrieben: ‚..deine Liebe benötigt einen mutigen jungen Mann‘ – also, warum jetzt plötzlich so schüchtern?“ Zahir ergriff die Hand meines Vaters, küsste sie und sagte: „Bitte verzeihen Sie mir, ich habe einen Fehler begangen.“
Mein Vater legte den Brief in Zahir’s Hand und sagte noch einmal: “Lies ihn laut vor.” Während Zahir zitternd vorlas, wuchs in den Gesichtern der Mitglieder des Militärrates die Verblüffung. Zahir beendete seinen Brief und der Moment war gekommen, da alle eine Ohrfeige verpasst bekommen sollten. Die erste Ohrfeige kam, als mein Vater sagte: „Entschuldige dich nicht, denn du hast keinen Fehler begangen. Ich bin sehr stolz auf dich. Das nächste Mal, wenn du einen solch schönen Brief an meine Tochter senden möchtest, komm damit zu mir und ich werde ihn unter ihr Kissen legen. Oder gib ihn einem ihrer Brüder. Und stottere morgens nicht.“
„Und ihr, schämt ihr euch etwa nicht!?“, und er richtete das Wort direkt an den Militärlehrer. „Haben Sie etwa nicht eines Tages gelernt, dass man keine Briefe lesen darf, wenn sie nicht Ihren Namen oder etwa Ihre Adresse tragen!? Dieser Brief ist an meine Tochter adressiert und Sie haben nicht das Recht dazu, auch nur einen Buchstaben davon zu lesen! Und Sie“ – und er richtete sich an Samira – „Sie wurden wohl von mir enttäuscht, nicht wahr? Und Sie, Lehrer Ahmad, Sie werden sich beim Zählen definitiv verrechnen – Sie werden niemals herausfinden, wie viele Briefe zu meiner Tochter gelangen werden. Was für eine Schande!“
Der Wächter der Liebe
Ich hatte Zahir bis dahin nie kennengelernt. Es war das erste Zusammentreffen mit ihm, damals im Militärrat, aber es war nicht das Letzte. Während eines ganzen Jahres wartete er jeden Morgen darauf, dass ich aus dem Haus kommen würde, um an meiner Seite gehen zu können. Seit jenem Tag stotterte er nicht mehr, vielmehr wurde er Experte im Zurufen eines Hallos. Er wurde zum Wächter der Liebe, die in seinem Herzen wohnte. Er hat mir seitdem nie mehr geschrieben, sein erster Brief war auch sein Letzter. Ich sagte Zahir, dass ich ihn nicht lieben würde, dass ich zu jung wäre für die Liebe. Es war aber nicht deswegen, dass Zahir keine Briefe mehr schrieb, sondern weil seine Briefe von nun an von seinen Lippen kamen. Es verging kein Tag, an dem Zahir mir nicht seine Liebe bekundete, und jedes Mal kam es mir vor, dass seine Liebe grösser wurde, aber so wuchs auch meine Furcht.
Jahre vergingen und wir wurden älter, und Zahir wartete jeden Morgen am gleichen Ort auf mich.
Und so flogen die Jahre dahin, und ich merkte jeden Morgen mehr, dass eine Militäruniform für mich total unpassend war. Ich brüllte wie ein Büffel in der Herde und fand mich eines Tages verstossen wieder, wie ich da alleine brüllte.
Schweizer Regen und ein Arabischer Kuss, der nach Kardamom schmeckt
Hier, in der Schweiz, im Angesicht der Berge und am Fluss stehend, warf ich den Umhang der Politik ab und warf mir meinen eigenen Mantel über. Dieser Mantel ist leicht und durchsichtig, er sitzt mir gut und behindert meine Bewegungen nicht. Ich kann damit gleichzeitig tanzen und rennen, und der Mantel kann zwei Flügel ausfahren, mit denen ich fliegen kann, hoch hinaus fliegen. Der Mantel faltet sich auch zusammen, damit ich gut landen kann. Wie schön er doch ist! Er ist bestickt mit den Buchstaben des Alphabets. Nun muss ich nicht mehr beweisen, wer das Subjekt ist und wer das Objekt. Ich selbst wähle bloss die Buchstaben aus und vereine sie, ganz ohne einen grammatikalischen Vertrag und ohne eine politische Erlaubnis. Ich lasse die Vermählung der Wörter mit meinem Gesang hochleben. Wie schön ist es doch nun, mein Brüllen!
Er lächelte und sagte zu mir: “Wie sehr ich doch das Wort ‘Al Khwar – das Brüllen’ mag.” Ich antwortete ihm: „Es ist ein weiblicher Büffel, der schreibt, und nicht ein weiblicher Mensch.“ Er küsste mich, währendem ich Kaffee schlürfte und so kam es, dass der Kuss nach Kardamom schmeckte. Es war nicht ein Kuss wie alle anderen Küsse, und ich war ein weiblicher Büffel, also ungleich anderen Menschen.
„Wird die Geschichte so enden?“, frage mich mein Schatz.
„Nein, mein Lieber, Liebesgeschichten enden nicht, sie sind nur ein Anfang.“
Fortsetzung folgt.
Zaher Al Jamous
14/02/2021
Anmerkung für den Leser:
Mein Familienname ist “Al-Jamous”, was auf Arabisch „der Büffel“ bedeutet. Deswegen soll in diesem Text das Wort als „der Büffel“ übersetzt und verstanden werden.
Bevor die Schülerinnen und Schüler in Syrien in ihre Klassenräume gehen, müssen sie morgens vor der Syrischen Flagge salutieren und den Präsidenten Baschar al-Asad hochleben lassen. Früher war es sein Vater, Hafez Al-Asad. Wir haben auch militärische Schulfächer, wo wir die Grundätze des Militärischen lernen wie etwa das Marschieren, sowie auch, wie man eine Waffe auseinander nimmt und wieder zusammensetzt. Auch lernen wir das Benützen der Waffe. Der militärische Unterricht beginnt im siebten Schuljahr, also in der Sekundarschule, und die Schülerinnen und Schüler müssen auch eine militärische Uniform tragen. Sodass wir alle zusammen Soldaten Asads werden sollten – so nannte man uns auch in der Schule.
Der Lehrer des Militärfaches hatte eine irreguläre Autorität über alle anderen. Das bedeutet, dass er in den Herzen der Schülerinnen und Schüler Angst säte, und dies nicht nur durch strenge Anordnungen, die nichts mit Erziehung oder Schule zu tun hatten, sondern auch durch die Militäruniformen. Dies alles ist politische Symbolik, die zum Ziel hat, die Leute dem Diktat des Regimes von Al-Asad und seiner Entourage zu unterwerfen. Es sollte hier auch erwähnt werden, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die später am Institut für Sport und Militärisches studierten, und die später Lehrerinnen und Lehrer für Militärisches wurden, meist diejenigen waren, die in der Sekundarschule schrecklich abschnitten.
Zaher Al Jamous wurde 1978 in Syrien geboren. Sie studierte englische Literatur an der Universität Damaskus. Sie ist Journalistin, arbeitete für das syrische Fernsehen und unterrichtete Englisch an syrischen Schulen. Al Jamous flüchtete mit ihren drei Kindern in die Schweiz, um in Bern eine zweite Heimat zu finden.
 Der Web Magazin www.lucify.ch wurde von hochausgebildeten Frauen mit Migrationshintergrund gegründet, die sich ihren Platz in den Schweizer Medien seit 3 Jahren erfolgreich erkämpft haben und einnehmen. Neben ihrem journalistischen Engagement haben Zaher Al Jamous (Syrien), Maya Taneva (Nordmazedonien), Anna Butan(Russland), und Faten Al Soud (Irak) ihren Beruf als Schriftstellerinnen weiterverfolgt und so wurde ein Teil des Lucify Kollektivs in eine Gesellschaft der Schriftstellerinnen umgewandelt. Die Lucify Schriftstellerinnen sind an Zuwachs interessiert und kreieren ein wichtiges Netzwerk der Schriftstellerinnen mit Migrationshintergrund in der Schweiz.
Der Web Magazin www.lucify.ch wurde von hochausgebildeten Frauen mit Migrationshintergrund gegründet, die sich ihren Platz in den Schweizer Medien seit 3 Jahren erfolgreich erkämpft haben und einnehmen. Neben ihrem journalistischen Engagement haben Zaher Al Jamous (Syrien), Maya Taneva (Nordmazedonien), Anna Butan(Russland), und Faten Al Soud (Irak) ihren Beruf als Schriftstellerinnen weiterverfolgt und so wurde ein Teil des Lucify Kollektivs in eine Gesellschaft der Schriftstellerinnen umgewandelt. Die Lucify Schriftstellerinnen sind an Zuwachs interessiert und kreieren ein wichtiges Netzwerk der Schriftstellerinnen mit Migrationshintergrund in der Schweiz.

 Andri Beyeler, geboren 1976 in Schaffhausen, lebt in Bern. Mitglied der freien Tanz-Theater-Gruppe Kumpane. Mehrere Theaterstücke, Bearbeitungen und Übertragungen. 2017 wurde er von der Stadt Bern mit dem Welti-Preis für das Drama ausgezeichnet. 2018 erschien bei Der gesunde Menschenversand «Mondscheiner«, eine Ballade.
Andri Beyeler, geboren 1976 in Schaffhausen, lebt in Bern. Mitglied der freien Tanz-Theater-Gruppe Kumpane. Mehrere Theaterstücke, Bearbeitungen und Übertragungen. 2017 wurde er von der Stadt Bern mit dem Welti-Preis für das Drama ausgezeichnet. 2018 erschien bei Der gesunde Menschenversand «Mondscheiner«, eine Ballade.


 Der Web Magazin
Der Web Magazin 
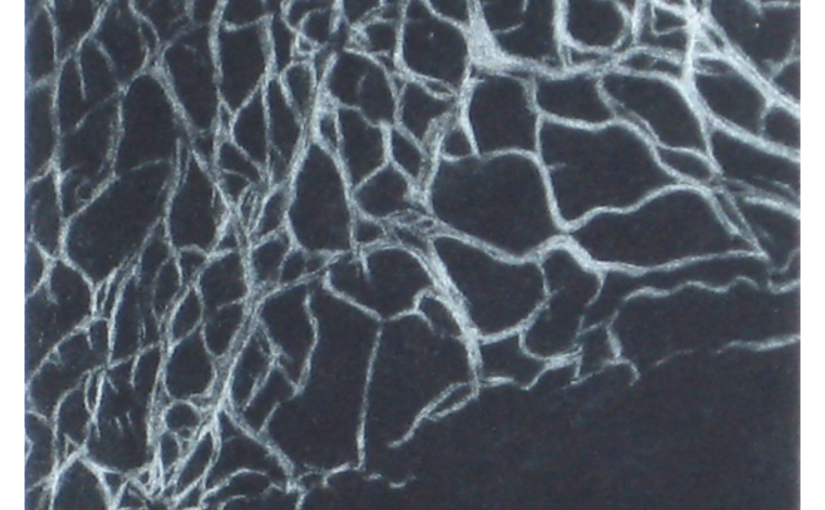
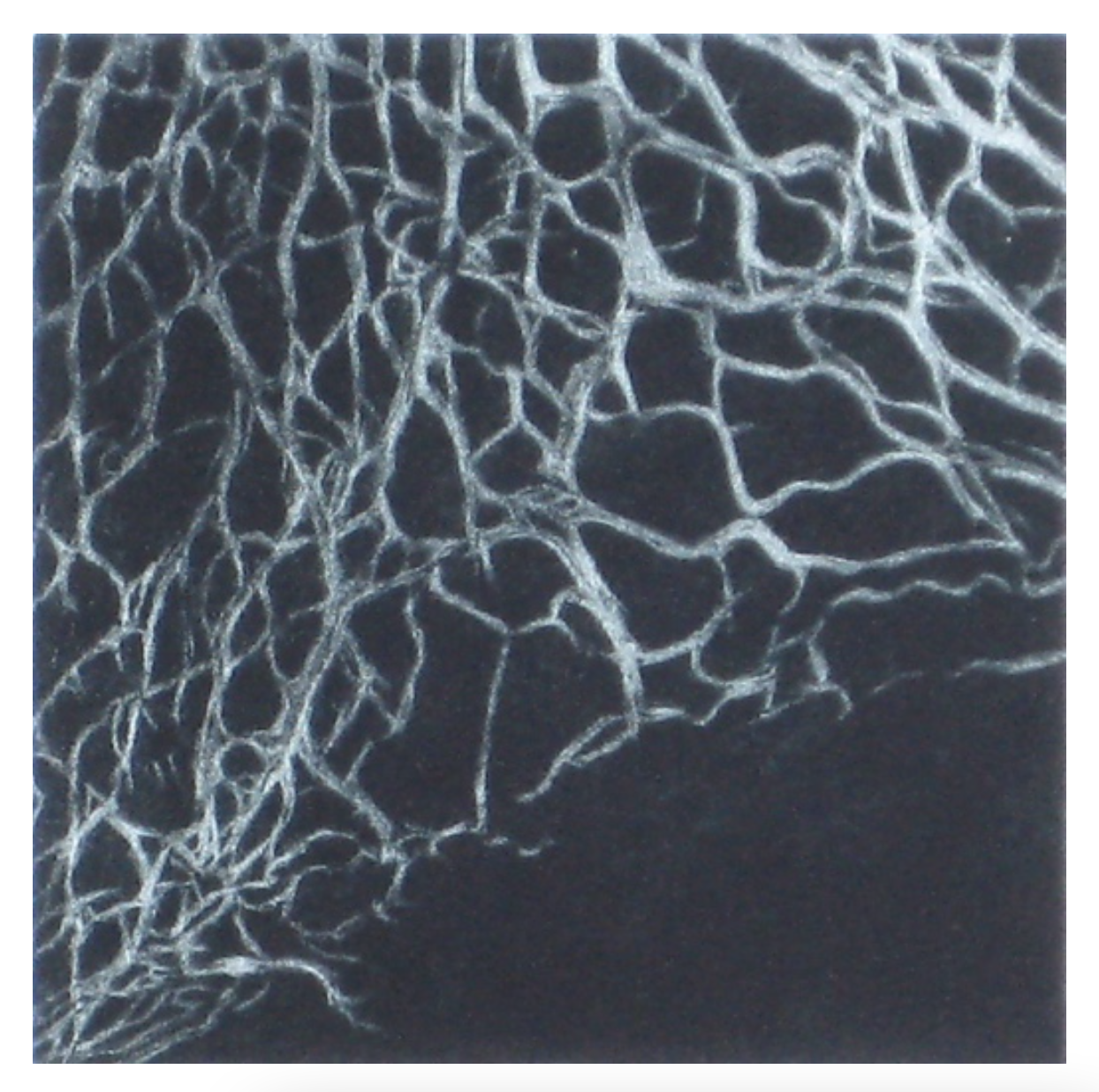









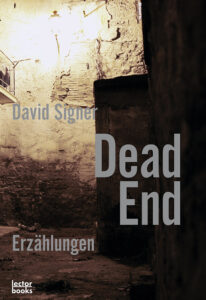 David Signers acht Erzählungen in «Dead End» kreisen um biografische Wendepunkte, an denen bisher geregelte Existenzen aus den Fugen geraten. Eben noch im Alltag verhaftet, finden sich die Protagonisten plötzlich an fremden, düsteren Orten wieder. In Situationen, die sie überfordern. Oder in denen ihr Leben zu einem jähen Ende kommt. Dead End.
David Signers acht Erzählungen in «Dead End» kreisen um biografische Wendepunkte, an denen bisher geregelte Existenzen aus den Fugen geraten. Eben noch im Alltag verhaftet, finden sich die Protagonisten plötzlich an fremden, düsteren Orten wieder. In Situationen, die sie überfordern. Oder in denen ihr Leben zu einem jähen Ende kommt. Dead End.