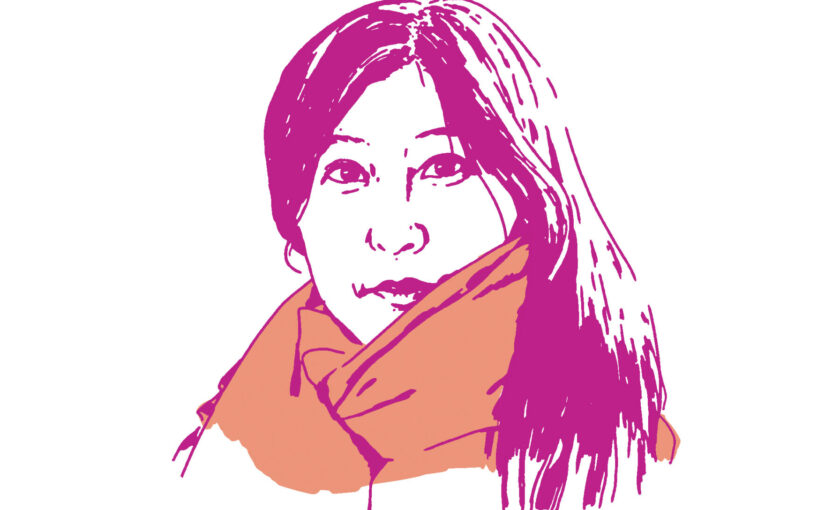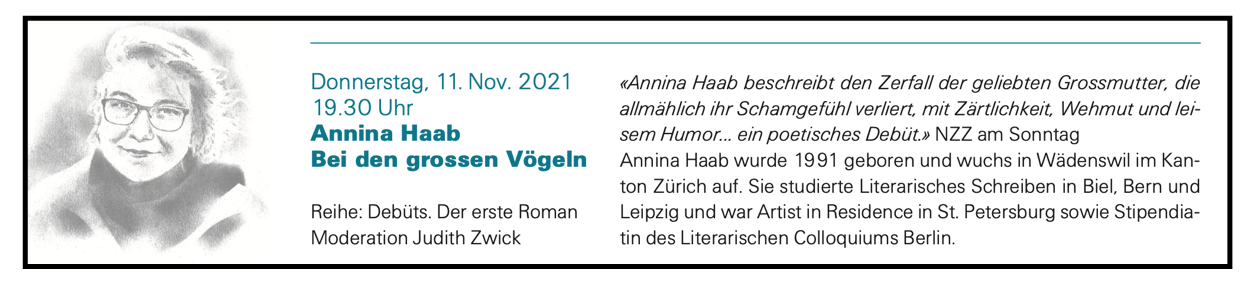Der Brief am letzten Tag im Jahr. Ausgerechnet! Er kam von ihm. Ich nehme ihn als Zeichen. Er könnte auch vom Vater geschrieben worden sein. So antworte ich nun dir, nicht dem, der ihn auch geschrieben haben könnte. Er ist nicht Vater, meines Wissens hat er keine Tochter. Er hat auch keine Ahnung, wie das so ist, wenn man wieder Tochter eines bekannten Mannes wird, der einem fremd wird in dem Augenblick, wo es um das Gleiche geht, denn beim Lesen dieses Briefes wurde ich wieder die Tochter, deine, und was den Brief betrifft, auch seine. Es ist ausserordentlich, was einem Brief gelingt: alle neuen Vorsätze, die auch, nebst andern, sich um dieses Loslassen drehten, gleich Eintagsfliegen über den Haufen zu werfen. Für ein paar Stunden leben, um dann zu sterben.
Ich war an diesem Tag leicht und beschwingt und voller guter Vorsätze für den nächsten Tag, der ja der erste im neuen Jahr war, bis der Brief kam und das Ausgewogene in ein Gewicht hinein pendelte, das ich – ohne Brief – nicht auf die Waage brachte.
Dein Verdienst, Vater, ist es, dass es mich gibt, obwohl ich immer das Gefühl hatte, genau das nicht verdient zu haben. Das Verdienst des Schreibers ist: auch er hat es dir zu verdanken. Ohne es zu wissen, müsste er dir dankbar sein, in deiner Tochter die richtige Adressatin gefunden zu haben. Eine Vatergekränkte. Eine, die Vergleiche herstellt, eine, die im neuen Geräusch das alte zu hören vermeint, und, als ob du gerade erwacht wärst aus dem Totenreich, war deine Stimme zu hören in diesem Brief!
Dem Schreiber ist das nicht bewusst. Dir Vater war es auch nicht bewusst, was du in mich eingeschrieben hast. Und Briefe hast du mir nie geschrieben. Erst nach Mutters Tod Glückwünsche zum Geburtstag, Weihnachtskarten. Mehr als die nötige Fortsetzung von Mutters Gewohnheit war das nicht. Obwohl du eine schöne Schrift hattest, schrieb immer sie! Aber Briefe waren das nicht wirklich.
Einmal, bei mir am Tisch, hast du zum ersten und letzten Mal die von mir gekochte Polenta als die beste gerühmt, die du je gegessen hättest. Ich stand vom Tisch auf, ging in die Küche, schaute dort aus dem Fenster, wusch das schon gebrauchte Besteck oder vielleicht wusch ich auch ungebrauchtes sauberes Besteck, kämpfte mit der Rührung, kämpfte mit den Tränen, kämpfte mit dir, von dem ich nie etwas in diese Richtung Gehendes erwartet hatte: ein Kompliment! Wieder am Tisch, hast du dir von mir eine weitere Portion Polenta schöpfen lassen! Ich stand neben dir und fuhr dir ganz kurz mit der Hand über deine Glatze, von der seitlich noch einige wilde, graue Haare abstanden.
Du übertreibst!
Das würdest du auch jetzt sagen, wenn du den Brief des Schreibers lesen könntest. Selbstverständlich hätte ich ihn dir nie zu lesen gegeben. Du hättest dich darin erkannt und sofort gesagt: jetzt übertreibst du wieder einmal tüchtig. Meine Tüchtigkeit war aber nicht die Übertreibung! Vielmehr war es immer die Suche nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen dir und mir. Zuletzt die Erkenntnis, dass es vergeblich war. Du wolltest der immergleiche Vater bleiben, ich die Tochter, die mehr als nur diesen einen Vater wollte, der jede nur denkbare Zumutung an sie mit dem Satz: DU ÜBERTREIBST, abschmetterte. Unzählige Situationen, an die zu erinnern ich mich nicht weigern noch wehren kann, weil sie mir fortlaufend begegnen. Aha, denke ich dann, manchmal sage ich laut: schon wieder und hie und da wird es gröber: leckts mich doch alles am Arsch. Auch dieses Gröbere schliesst die Nuancen mit eigentlich feinen Rissen nicht aus. Damit sie nicht schmerzen, denke ich ganz einfach grob wie beim gerade gelesenen Brief: Verdammtes Arschloch!
Zuerst rieb ich mir die Augen, als ob ich gerade erwachte, dann war ich wieder wach, hellwach! Lässt es sich noch mehr steigern das Wort? Am Hellwachsten! Tatsächlich stieg mir das Blut und eine Röte stieg mir in die Sprache: Zornig und keifend, wie ein Weib mit einem abschmetternden Brief ihres Liebhabers in der Hand, war ich eine in Rage geratene Tochter, die mit zwei gleichen und doch verschiedenen Vätern am Tisch sitzt, in exaktester Wiederholung zwei gleiche Erzieher in väterlicher Pose sieht, in gleicher, erzieherischer Anwandlung. Unbegreiflich, das erwachsene Kind sehen sie nicht in mir, sie sehen mich in einem erwachsenen Körper als Kind! Nicht einen einzigen Riss bekam der Brief ab, denn ich wollte und musste ihn immer wieder lesen können, so wie man ein Gedicht immer wieder lesen will, das einem aus irgendeinem Grund erregt.
Ich bin wieder bei dir im Krankenzimmer.
Es waren die letzten Stunden, die du bei Bewusstsein warst. Der letzte Gang mit dir auf die grüngekachelte Spitaltoilette. Ich hielt dich am Arm, setzte dich auf die Klobrille. Mit beiden Händen hast du meine beiden Hände gehalten, mir deine müden Augen zugewandt und gesagt: JETZT STERBEN WIR. ich dachte: DU ÜBERTREIBST. Ich putzte deinen Hintern, widersprach deinem WIR nicht. Ich fragte mich bloss, da in diesem intimen Geschehen, warum es das WIR so selten in weniger traurigen Momenten gegeben hatte. Ich war versucht, während ich dir die Scheisse wegputzte, zu sagen, ich liebe dich. Stattdessen strich ich dir das Papier, so sanft wie nur möglich und wie einen Liebesbeweis, über deinen After, zog dich hoch und legte dich zurück ins Bett, deckte dich zu wie ein Kind, das unruhig noch eine Weile in einem angestrengten Wachen bleiben will, um dann in einen Schlaf zu versinken, aus dem es kein Erwachen mehr gab.
Der Briefschreiber lebt ganz arglos, denke ich, lebt er mit diesem an mich versandten Brief. Ich brauch aber keinen neuen Vater, der mir erklärt, dass mein Sein seinem sich vorgestellten nicht entspricht. Er war ganz nett zu mir, solange ich keine Fragen stellte. Noch immer weiss ich es nicht, dass ich keine Fragen stellen darf. Fragen stellen, das verwandelt mich augenblicklich in ein unbeliebtes Kind!
Ich habe dem Vaterschreiber nicht zurückgeschrieben. Ich blieb bei mir und Vater, lese den Brief, wieder und wieder passiert sie mir, diese väterliche Schrift. Nachts im Traum erschütterte mich ein Weinen. Als hätte ich dem Schlaf den Auftrag erteilt, es nur in seiner Tiefe zuzulassen. Mit trockenen Augen erwachte ich am Morgen und wie die Zuschauerin eines seltsamen Geschehens triftete ich in den Tag ab. In den ersten Tag im Jahr. Der Brief liegt auf dem Tisch und Vater liegt im Grab. Plötzlich ist der Brief ein Grab, aus dem Vater spricht. Zunehmend verschwindet der eigentliche Schreiber.
JETZT STERBERN WIR
Ich fühlte deine Hände in meiner Hand. Die Handlung an deinem Rücken. Und dass du dann nicht mehr erwachtest, nachdem ich dich zudeckte, forderte andere Formen von Liebe. Mit eingenässten, kühlen Lappen fuhr ich dir über deine heissgewordene Stirn, von einer Seite zu andern während auf den beiden Seiten deines Gesichts Schweisstropfen ins Kissen fielen, deine Atemzüge immer länger und länger und dann ruhiger wurden.
Ich lebe, entgegen deinem vorgebrachten WIR. Ich nahm es nicht persönlich, so wie ich den Brief des Vaterschreibers jetzt auch nicht mehr persönlich nehme. Es ist ein Fragment, oder die Kopie einer ungeheuren Kraft, die Möglichkeit, dich langsam zu begraben.
Das Jahr hat erst angefangen.
Draussen liegt Schnee. Die Bäume schütteln ihre Schultern. Staub fällt.
(Unveröffentlichte Erzählung)
die dunkelheit
erhellt alle gedanken
in ihnen geistern
geschichten das leben
ich liege schlaflos da
die erste Liebe zieht
an mir vorbei wie ein
schwan den ich zum
ersten mal richtig sehe
was ich klar erkenne
ich war nicht dabei
immer schon beim
nächsten vergänglichen
spiel der film schmerzt
ich schliesse die augen
der schlaf steht wach
am see leise gleitet
das leben übers wasser
verschwindet in die tiefen
die jede regung kennt
wenn die fische schlafen
gestaltet sich das angeln
leicht