Wer schreibt angesichts von Klimakrise und Krieg, bitteschön, noch über sich selbst und falls ja, über wie viele denn überhaupt, und wenn das hier schon am Anfang so kompliziert wird, wird doch jede anständige Leserin den Tab sowieso gleich wieder schließen, und du kannst dir die ganze Schreiberei sparen.
Um es kurz zu machen: Ein Text, in dem jemand irgendwann einen Marathon läuft und dann alles besser wird, wird das hier nicht werden. Die Entscheidung, ob jemand deinen Text lesen will, wird sicher keine drei Sekunden in Anspruch nehmen. Die Person wird sich vermutlich fragen: „Habe ich Lust, das hier zu lesen?“; „Habe ich überhaupt die Zeit dazu?“ und zack, weiß sie Bescheid. In deine Lage hingegen versetzt sich kaum einer. In dich, die du jetzt und hier entscheiden sollst, ob du diesen Text schreiben sollst – oder lieber nicht. Dabei geht es hier um eine Entscheidung, die extrem weitreichend ist, weil sie deine ganze schreibende Zukunft betrifft.
Du weißt es also noch nicht, du zauderst noch. Und selbst wenn du dich zum Innersten entscheiden solltest, bleibt fraglich, ob du es überhaupt noch kannst. Solltest du ihn aber irgendwann doch geschrieben haben werden, heißt dies noch lange nicht, dass ihn jemand lesen wird.
Es sind also, um den Gedanken ein wenig abzukürzen, recht viele Zufälle und Wunder von Nöten, damit ein Text seinen Weg geht. Und wenn er tatsächlich einst geschrieben worden sein wird und Sie ihn bis zu diesem Punkt gelesen haben sollte, dann sollten Sie ihn schon deshalb bis zum Ende lesen, weil sein Entstehen mindestens so unwahrscheinlich war, wie mit Mitte vierzig noch spontan schwanger zu werden.
Einen Text über sich selbst schreiben zu wollen und das auch noch öffentlich kundzutun, statt es nur heimlich als Möglichkeit zu denken, ist ein ziemliches Wagnis. Um nicht zu sagen, reichlich hirnverbrannt. Kurzum, die Frage „Warum dieser Text?“ wäre noch kurzfristig zu klären.
Du versuchst es mal. Am Abend und in der Nacht, wenn dein Kind schläft und wilde Träume hat von Piraten und Schildkröten und seiner Oma. Du hast festgestellt, dass etwas in dir leckt, und Sie dürfen sich nun gerne eine Zunge vorstellen, so eine rote wie die der Rolling Stones, falsch ist das sicher nicht, doch du dachtest eher an ein Schiff, das langsam mit Wasser vollläuft, um dann irgendwann Schlagseite zu bekommen und zu sinken. Du bist also, um im Bild zu bleiben, die Kapitänin eines beunruhigend schlingernden Schiffs. Und da hast du dir gedacht, weil ja Selbstfindungstexte gemeinhin recht erfolgreich sind, dass du vielleicht auch einen schreiben solltest. Natürlich nicht irgendeinen. Texte, die die Welt nicht braucht, gibt es bekanntlich schon genug. Wenn also, dann gilt es einen zu produzieren, den sie braucht. Einen, der Anfang, Mitte und Ende hat und bei dem man beim Lesen irgendwie verändert herauskommt. Ein Text der Nächte, des Dunklen und Verdrängten. Aber auch dessen, was inwendig leuchtet und strahlt. So wie die Seele.
Dazu fändest du gerne eine Sprache wie Wasser, transparent, warm in der Sonne und im Schatten kühl, mit kleinen Fischen darin, die allesamt nicht mehr bedeuten, als was sie sind: kleine Fische in einem klaren Bach. Sprachflüsse sind etwas Herrliches, und wer sich je als Ursache eines solchen Flusses erlebt hat, wird deine Sehnsucht verstehen, diese Quelle im Inneren wiederanzapfen zu wollen. Insbesondere dann, wenn sie lange ausgetrocknet war und versiegt und verloren schien.
Quellen sind, neben den Menschen, wohl die eigenwilligsten Geschöpfe Gottes. Die ewige Quelle, die du Gott nennst, schafft auch andere Quellen. Solche, die sich, längst versickert und vergessen, plötzlich wiederbeleben können. Auch der nichtswürdigste Schreiberling kann jederzeit mit einem neuen Buch reüssieren, kann plötzlich wieder Götterliebling sein. Dass Gott seine Quellen (ebenso wie die Dichter) besonders liebt, sieht man daran, dass er ihnen die Fähigkeit zum Schöpfen quasi vererbt hat – und schon bist du kurz davor, dich selbst als gottähnliches Wesen darzustellen, was sicherlich dem ein oder der anderen sauer aufstoßen mag, aber dafür kannst du nichts. Möge man den herabfließenden Sprachfluss des Hochmuts bezichtigen und dich verschonen.
Es liegen also Jahre der Dürre hinter dir, Jahre, in denen du kaum etwas Gescheites zu Papier brachtest und kein Brünnlein floss. Stattdessen spiest du dann und wann wütende Sprachbrocken aufs Papier, zähe Ungeheuer, die sich später nur im Geheimen und unter großer innerer Pein von ihrer Schöpferin lesen ließen. Inkognito ergo non sum, wie der stümpernde Lateiner in dir sagt: Solange du dich nicht mit deinem Geschriebenen identifizierst, gibt es dich nicht.
Doch dann hast du dir eines schönen Tages gedacht, dass du es eigentlich nicht einsiehst dich auszulöschen. Du hast es satt, deinen Kopf in den Sand eines zugekackten Spielplatzes zu stecken. Du fühlst endlich wieder etwas in dir. Und lass es einfach Wut sein.
Moment bitte, es klingelt.
An der Tür war ein junger Mann von der Telekom, der eine Glasfaserleitung verlegen wollte, also natürlich nicht sofort, sondern demnächst. FTTH heißt diese Faser, was dich an die unzähligen FDH-Diäten deiner gottlosen Jugend erinnert, aber die Unterschrift über den Vertrag, der besagt, dass du dann die nächsten zwei Jahre dein Internet bei der Telekom bezahlst, die wollte er sofort.
„Entschuldigung, aber das kann ich nicht so schnell entscheiden“, hast du gesagt, du bräuchtest eigentlich keine so schnelle Leitung.
Wobei du natürlich nicht weißt, ob du sie nicht doch brauchst, solange du sie nicht getestet hast. Der menschliche Geist gewöhnt sich ja an nichts schneller als an Komfort, Schnelligkeit und Bequemlichkeit. Und eine schnelle Leitung, die wäre ja vielleicht doch gut, gibt es die auch für den Kopf, das hättest du den jungen Mann einmal fragen sollen.
Jedenfalls warst du noch nie gut im Abwimmeln, weshalb ihr sicher zehn Minuten im Flur herumstandet, und vielleicht hättest du ihm einen Kaffee anbieten sollen. Und ihn dann fragen, ob er sich nicht ein bisschen ausruhen will bei dir auf dem grauen Sofa, wo man W-Lan Empfang hat. Vom Feinsten. Kupfer wird gemeinhin unterschätzt, man denke nur an die Spirale zur Verhütung; und dein Internet mit seinen Kupferdrähten, das funktioniert wirklich tadellos.
Jetzt ist er jedenfalls wieder gegangen, aber nur kurz, da du sagtest, dass du erst deinen Bruder anrufen müssest, der sei nämlich Glasfaserspezialist und kenne sich mit allen Einzelheiten aus. Bloß hat der Bruder gerade keine Zeit und jetzt liegt das Handy neben der Tastatur, und gleich wird der junge Mann wieder an der Tür klingeln, und du fühlst dich wie diese tapfere, weißgelockte Lady in Herbie, deren Haus in einer riesigen Baubrache als einziges noch steht ,aber von Alonzo Hawks Abrissbirne bedroht wird, der ein 130 Stock hohes Plaza just an der Stelle bauen will, wo die gute alte Frau Steinmetz schon seit vielen Jahrzehnten zu Hause ist. Nicht, dass das Haus, in dem deine Wohnung sich befindet, abgerissen werden soll, nein, so ist es nicht. Doch betrachtet man es, könnte man meinen, es wäre vielleicht besser, wenn es jemand täte.
Nun denn, das ist viele Stunden her. Hallo zurück. Du kannst leider nicht sagen, ob der Junge nochmal wiedergekommen ist, denn zwischendurch warst du beim Italiener und hast deinen Entschluss, den Text zu schreiben, komme was wolle, gefeiert. Hast einen großen Teller Pasta gegessen und einen mezzo litre vino della casa und mehrere Grappas getrunken, und jetzt willst du nur kurz gucken, ob das Brünnlein noch fließt oder schon wieder Ebbe eingesetzt hat. Dein Vertrauen in deine Fähigkeiten ist nämlich durch die Negativerfahrungen der letzten Jahre, gelinde gesagt, ein wenig erschüttert.
Wer weiß eigentlich, dass die Themse einer winzigen Quelle in einem Kaff namens Trewsbury Mead entspringt? Einer Quelle, die so winzig ist, dass Wanderer sie regelmäßig für eine Pfütze am Wegesrand halten? Hätte nicht jemand einen dicken, grauen Stein zum Gedenken am Wegesrand aufgestellt, wüsste kein Schwein, dass hier ein bedeutender Fluss entspringt. Nun, die Schweine wissen es wahrscheinlich noch am ehesten, wenn sie sich an heißen Sommertagen an dem kleinen Rinnsal laben.
Du selbst bist auch auf einem Kaff aufgewachsen, in einem Zimmer voller Spinnen, und hattest dabei Haare so lang wie der Arm eines normalgroßen, ausgewachsenen Mannes. Deine Zeit vertriebst du dir zu je einem Drittel mit Schule, mit der minutiösen Dokumentation deines Lebens in Tagebüchern sowie Besuchen bei deiner besten Freundin im Fachwerkhaus gegenüber, deren Haar ebenso lang war wie deines. Ihr hattet einander wirklich gern, auch wenn ihr euch selbst hasstet und somit, nach landläufiger Sicht, gar keine Liebe hätten empfinden dürfen, denn Liebe gründet ja auf Selbstliebe. Das wusstest du aus den Büchern über das Selbstbewusstsein, die du damals last, weil du hofftest, die würden dich weiterbringen. Tagebuchschreiben gleicht einem sehr langen Blick in einen blinden Spiegel, es ist weder befreiend noch bringt es einen weiter. Und Jahre später, sollte man es denn mit viel Überwindung wagen, noch mal in eins dieser Bücher hineinzulesen, packt einen ein würgendes Gefühl des Ungenügens. Dein Schreiben von damals war aus heutiger Sicht ein Akt der Selbstvergewisserung und Identitätserzeugung. Wer warst du und wer wolltest du sein?
In deinem Kopf geisterten die Vorstellungen aus der Werbeindustrie, aus MTV und der Brigitte Young Miss, und generierten in dir jene oberflächlichen Zerrbilder der Schönheit, jene Ungetüme der Modewelt, die das pubertäre Selbst umkreisen und anzugreifen trachten, indem sie es von jenen Werten entfernen, an die es sich eigentlich schmiegen sollte: Liebe und Achtung und Respekt und Bewusstsein. Als Kind hattest du, um dein Ungenügen zu vergessen, in eskapistischer Weise Mädchenbücher gelesen, anschließend schriebst du Tagebücher voll. Später Bücher.
Der wichtigste Unterschied zwischen dem Konsum und der Produktion von Literatur ist wohl der, dass man beim Schreiben, theoretisch zumindest, die Möglichkeit hat, zu produzieren, was man selbst gerne lesen würde. Denn Schreiben und Lesen sind eng verknüpft. Der Akt des Schreibens wird durch das gleichzeitige Lesen selbst zu einem ästhetischen, einem wahrnehmenden Akt. So last du also beim Tagebuchschreiben tagtäglich dein eigenes Leben, du erzeugtest es und schufst dein Dasein, indem du Worte suchtest für dein Suchen, deine Verzweiflung und deine Sehnsucht nach Besserung.
Die Katalogmädchen, denen du so gerne ähneln wolltest, wurden nachmittags in die Eis-Disco eingeladen oder tänzelten beim Leistungsturnen auf Schwebebalken herum. Du lagst nach der Schule auf dem Sofa, aßt Schokolade und schriebst.
Heute, da die zweite Lebenshälfte angebrochen ist und ein Gefühl der Endlichkeit den Horizont deiner Erfahrungswelt begrenzt, liegt dir viel daran, dem Augenblick auf die Schliche zu kommen. Beim Schreiben jedes einzelnen Wortes zeigt sich die gerade vergangene Vergangenheit, während die Zukunft – das wartende, immer schon in den Startlöchern des Vorbewussten sitzende Wort – eben dabei ist sich zu erfüllen. Und zwischen beidem liegt das Ungreifbare, Unfassbare, das wir Gegenwart nennen. Jener Augenblick, der nie ganz da ist, sollte man meinen, da er, wenn man ihn fassen will, schon wieder verflossen ist. Du siehst also die Wörter vor dir wie durch Zauberhand entstehen, denn die Signale, die vom Gehirn zu den Muskeln führen und so die Gedanken in etwas Lesbares verwandeln, bleiben unsichtbar. Man kann sie nicht beobachten, diese Impulse, die aus Gedanken Sprache oder sogar Literatur machen. Vielleicht hat ja die ganze Schriftstellerei weniger mit Begabung zu tun als mit dem Entdecken dieses Mechanismus, jener eigentümlichen Lust, die den Schreibenden überkommt, wenn er bemerkt, dass er nicht mehr und nicht weniger ist als der Mittler eines notwendigerweise verborgen bleibenden Prozesses, den du für ein zentrales Moment jener Tätigkeit hältst, die du jetzt und hier, an diesem herbstlichen Vormittag, ausführst.
Und so sitzt du heute, so viele Jahre nach deinem letzten Tagebucheintrag, wieder da und weigerst dich, dich thematisch zu veräußern, dich irgendwo ‚reinzulesen‘ oder ‚reinzufühlen‘, um dann irgendeinen Lebensweg darzustellen oder ähnliches, weil du, wie du gestehen musst, beim Schreiben nach wie vor am liebsten in deiner eigenen Gesellschaft bist. Es ist sicher nicht besonders schlau, über sich selbst zu schreiben. Andererseits schreiben in letzter Instanz alle über sich selbst. Es ist ihr eigener Erfahrungsschatz, den sie dem vermeintlich Anderen überstülpen. Wer hingegen über sich selbst schreibt, schreibt zugleich immer auch über das Andere.
„Was als Fremdes abstößt, ist nur allzu vertraut“, stellten Horkheimer und Adorno in Dialektik der Aufklärung klar, und im Umkehrschluss wird das Eigene bei näherer Betrachtung unvertraut – was das Schreiben über sich selbst zu einer Reise in völlig unbekannte Gefilde machen kann.
Wer eine Reise beginnt, ohne zu wissen, wo sie enden wird, geht das Risiko ein, sich zu verirren und für immer verloren zu gehen. Die große Chance aber besteht darin, auf Reisen einen Schatz zu finden. Dir wurde unlängst ans Herz gelegt, eine Therapie zu machen, und du hast dich dagegen entschieden. „Liebe dein Symptom wie dich selbst“, ruft der Zizek in dir. Es lässt sich ja nicht ausschließen, dass eine Therapie negative Konsequenzen für das weitere Leben hätte. Sie könnte zum Beispiel einer Beamtenlaufbahn im Wege stehen, falls du doch noch Lehrerin werden musst, oder, schlimmer noch, deinen gerade erst wiedererwachten Schreibimpuls abwürgen. Und es wäre doch schade, wenn Trewsbury Mead auf einmal trocken bliebe und keine Themse mehr ins Meer flösse. Auch der kleine Bär und der kleine Tiger finden einen Schatz, wähnen sich kurz im Reichtum und kehren letztlich mit leeren Händen nach Hause zurück. Ihre Erkenntnis: Zu Hause ist‘s am Schönsten.
Seit du diese Geschichte kennst, stellst du dir das mit dem Schatz der Selbsterkenntnis nicht mehr so hochtrabend vor. Eher so, wie Lacan sagt, dass ein Brief immer seinen Bestimmungsort finde. Wenn du ihn recht verstehst, meint er damit, dass es nicht so sehr auf die Botschaft ankommt, sondern darauf, sie zu verfassen. Und wenn du einen Brief schreibst, ohne ihn abzuschicken, dann ist seine Botschaft wahrscheinlich an dich selbst gerichtet. Du solltest dir also vielleicht die Tagebücher von damals noch einmal vornehmen und sie lesen wie nicht abgeschickte Briefe an dein heutiges Ich. Und dann folgt die Selbsterkenntnis? Eher nicht. Du jedenfalls rechnest nicht damit, dass dich plötzlich ein Spotlight erleuchtet und jene initialen Ereignisse deines Lebens sichtbar macht, die dazu geführt haben, dass du heute die bist, die du eben bist. Vielleicht gleicht deshalb auch dieser Text hier am ehesten einer Botschaft, die dich irgendwann ebenso zufällig erreichen wird wie Sie heute. Wichtig ist aber, dass das, was die Empfänger aus der Botschaft machen, nicht mehr in deiner Hand liegt. Aber genug der Abschweifungen. Obwohl sie dann gerechtfertigt sind, wenn der Anfang mehr als die Hälfte ist, wie Aristoteles sagte, denn wenn das stimmt, dann muss man sich besonders zu Beginn ordentlich ins Zeug legen. Du bist also jetzt fertig mit der Schilderung der Umstände, in denen du dich befindest und hast die Gründe für diesen Text hinreichend dargelegt. Hast dich entschlossen, die Reise anzutreten. Sie mögen selbst entscheiden, ob Sie dich begleiten wollen – oder lieber nicht.
 Julia Trompeter, geboren 1980 in Siegburg, studierte Philosophie und Germanistik in Köln. Nach ihrer Promotion lehrte sie Philosophie in Deutschland und den Niederlanden. Seit Kurzem ist sie an einer Schule in Berlin tätig, wo sie seit der Geburt ihres Kindes lebt. Sie schreibt Lyrik und Romane und arbeitet frei für die FAZ und den WDR. Für ihr Werk wurde sie u. a. mit dem Rolf-Dieter- Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln und dem Förderpreis des Landes NRWausgezeichnet. Ihr erster Gedichtband Zum Begreifen nah erhielt den Poesie-Debüt-Preis der Stadt Düsseldorf.
Julia Trompeter, geboren 1980 in Siegburg, studierte Philosophie und Germanistik in Köln. Nach ihrer Promotion lehrte sie Philosophie in Deutschland und den Niederlanden. Seit Kurzem ist sie an einer Schule in Berlin tätig, wo sie seit der Geburt ihres Kindes lebt. Sie schreibt Lyrik und Romane und arbeitet frei für die FAZ und den WDR. Für ihr Werk wurde sie u. a. mit dem Rolf-Dieter- Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln und dem Förderpreis des Landes NRWausgezeichnet. Ihr erster Gedichtband Zum Begreifen nah erhielt den Poesie-Debüt-Preis der Stadt Düsseldorf.
Webseite der Autorin
Beitragsbild © Peter Susewind
 Gabriela Cheng-Voser: In den letzten Monaten kämpfte ich mit einer Schreibblockade, so habe ich oft darüber nachgedacht, warum ich schreibe. Immerhin habe ich herausgefunden, dass ich mit meinen Texten Mitgefühl wecken möchte und dass mir die Menschen besonders am Herzen liegen, deren Ausgangslagen eher schwierig sind. Zudem habe ich eine Neigung zu Rollenprosa. „bittersüess“ ist der erste Text, den ich nach meinem Schreib-Stau für den Adventswettbewerb vom Literaturblatt eingereicht habe.
Gabriela Cheng-Voser: In den letzten Monaten kämpfte ich mit einer Schreibblockade, so habe ich oft darüber nachgedacht, warum ich schreibe. Immerhin habe ich herausgefunden, dass ich mit meinen Texten Mitgefühl wecken möchte und dass mir die Menschen besonders am Herzen liegen, deren Ausgangslagen eher schwierig sind. Zudem habe ich eine Neigung zu Rollenprosa. „bittersüess“ ist der erste Text, den ich nach meinem Schreib-Stau für den Adventswettbewerb vom Literaturblatt eingereicht habe.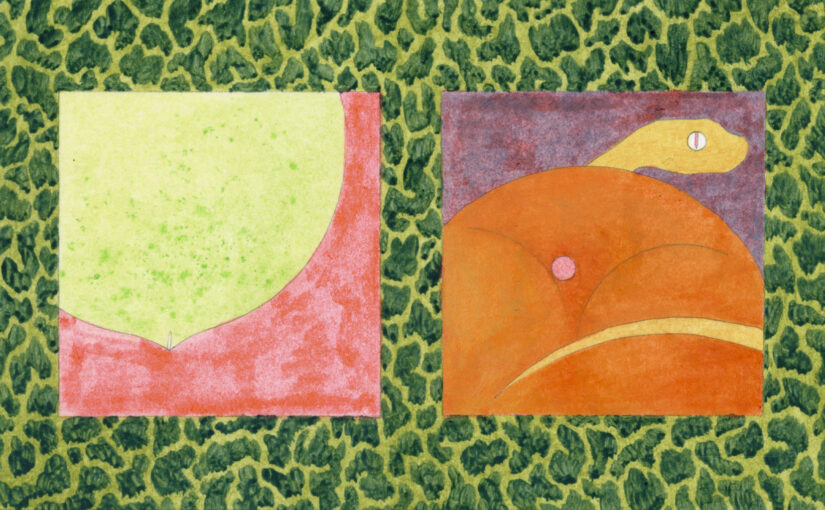
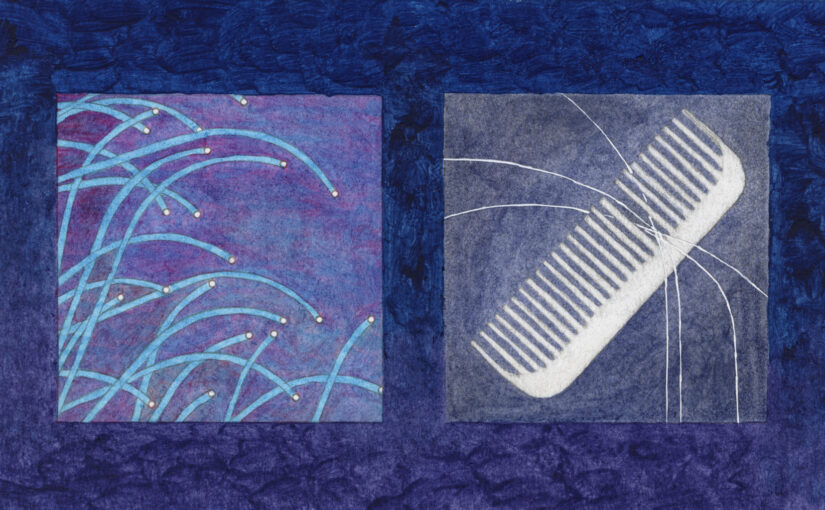
 Béatrice Bader
Béatrice Bader
 Tina Wodiunig, 1960*, lebt und arbeitet in Zürich. Während ihrem Ethnologie- und Sinologie-Studium lebte sie ein Jahr lang in China, danach begann sie in einem Museum zu arbeiten und absolvierte einen MAS in Museologie an der Uni Basel. Sie ist Mitglied der Autor*innen-Gruppe «Die aus Zürich». Derzeit arbeitet sie an einem Roman über ihre Grosstante, die in St. Gallen aufwuchs, nach Österreich ausgewiesen wurde und 1941 von den Nazis ermordet wurde.
Tina Wodiunig, 1960*, lebt und arbeitet in Zürich. Während ihrem Ethnologie- und Sinologie-Studium lebte sie ein Jahr lang in China, danach begann sie in einem Museum zu arbeiten und absolvierte einen MAS in Museologie an der Uni Basel. Sie ist Mitglied der Autor*innen-Gruppe «Die aus Zürich». Derzeit arbeitet sie an einem Roman über ihre Grosstante, die in St. Gallen aufwuchs, nach Österreich ausgewiesen wurde und 1941 von den Nazis ermordet wurde.

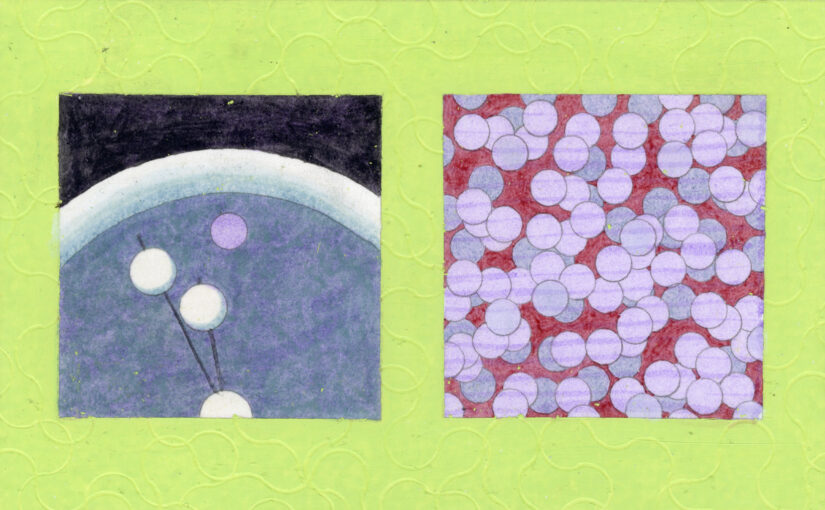


 Gabriela Caponio, 1975, wohnt im Kanton Zürich. Sucht in Archiven nach Geschichten, besonders nach Kriminalfällen aus dem Zürich der 20er. Das Interesse gilt allgemein dem Proletariat und den Unterprivilegierten.
Gabriela Caponio, 1975, wohnt im Kanton Zürich. Sucht in Archiven nach Geschichten, besonders nach Kriminalfällen aus dem Zürich der 20er. Das Interesse gilt allgemein dem Proletariat und den Unterprivilegierten.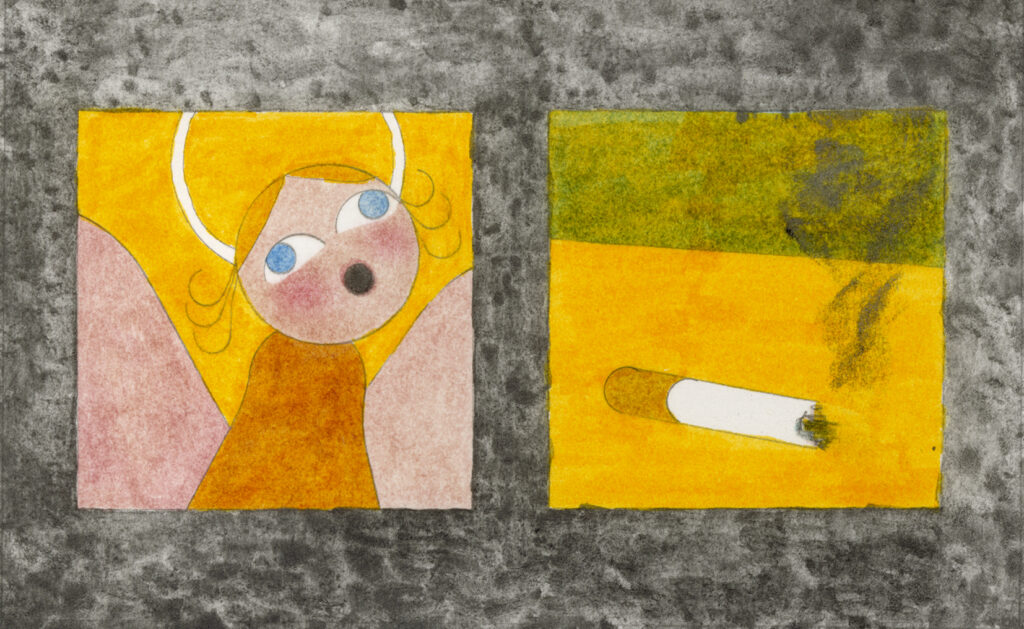
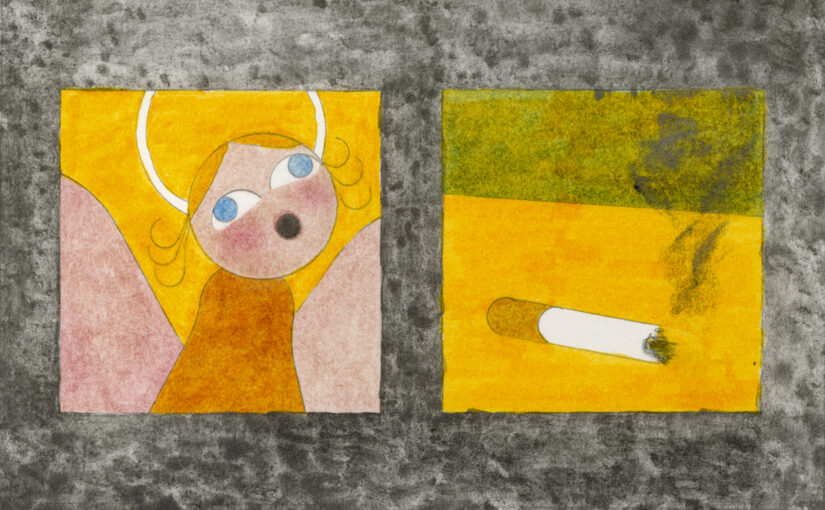
 Helmut Blepp, geboren 1959 in Mannheim, bis 2024 selbständiger Berater, lebt in Lampertheim, zahlreiche Veröffentlichungen in deutschsprachigen Zeitschriften und Anthologien, fünf Lyrikbände, zuletzt „Erinnerungen im Kartenhaus“ (Moloko plus, 2025)
Helmut Blepp, geboren 1959 in Mannheim, bis 2024 selbständiger Berater, lebt in Lampertheim, zahlreiche Veröffentlichungen in deutschsprachigen Zeitschriften und Anthologien, fünf Lyrikbände, zuletzt „Erinnerungen im Kartenhaus“ (Moloko plus, 2025)
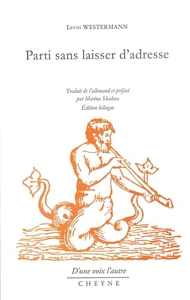 Levin Westermann, 1980 in Meerbusch geboren, studierte an der Hochschule der Künste Bern und lebt als freier Schriftsteller in Biel. 2020 wurde er mit dem renommierten Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg ausgezeichnet, 2021 mit den Schweizer Literaturpreis, 2022 mit dem Deutschen Preis für Nature Writing.
Levin Westermann, 1980 in Meerbusch geboren, studierte an der Hochschule der Künste Bern und lebt als freier Schriftsteller in Biel. 2020 wurde er mit dem renommierten Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg ausgezeichnet, 2021 mit den Schweizer Literaturpreis, 2022 mit dem Deutschen Preis für Nature Writing.



