Neukölln
»Dahinten.« Kareem zeigte durch die Blätter vor ihren Augen. »Die S-Bahn …« Sein Körper spannte sich.
Vom Bahnhof Hermannstraße kommend, tauchten die Scheinwerfer auf, noch fern. Der surrende Ton, den die Bahn mit sich brachte, erreichte die Ohren etwas später.
»Hmhm …« Issam steckte die Hände in die Hosentaschen. Schwieg. Rührte sich nicht.
»Jetzt ist es sowieso zu spät.« Kareem entspannte sich wieder.
»Wir müssen darüber reden, wie wir das genau machen«, sagte Issam.
Die Scheinwerfer waren fast auf ihrer Höhe, zogen unter der Brücke vorbei. Kareem und Issam schauten dem Vorortzug hinterher. Durch das Blätterwerk vor ihren Augen und über das Grün auf der Böschung am Gleis flackerten die Lichter vorbei.
»Was gibt es da zu reden? Ist doch alles gesagt.«
»Na ja … Ob wir erst losgehen, wenn die Lichter zu sehen sind. Zum Beispiel.«
Jetzt sagte Kareem keinen Ton.
»Oder ob wir rennen. Ich meine … Wir wollen ja nicht, dass es so lange dauert, weil wir wollen ja auch nicht, dass uns jemand sieht und so. Oder ob wir …«
»Da …« Kareem zeigte in Richtung Tempelhof, wohin die erste S-Bahn verschwunden war. Scheinwerferflackern, das Surren. Auch von dort kam eine S-Bahn. »Aber wir wollten ja die von der anderen Seite nehmen.«
»Hmhm …« Issam drückte mit einer Hand ein paar Zweige neben seinem Kopf zur Seite. »… also ob wir am Geländer warten. Wie oft kommen die um diese Uhrzeit? Und wie lange noch?«
»Woher soll ich das wissen? Immer noch ganz schön oft. Und am Geländer zu warten ist zu gefährlich. Was, wenn die Bahn dann einfach nicht kommt? Wir können da ja nicht so rumstehen. Dahinten …« Kareem zeigte nach Norden. »Da sind Leute.«
»Kommen die hier vorbei? Aber irgendwann fahren die auch nicht mehr. Die Leute …«
»Sieht so aus. Ja … irgendwann ist Schluss mit den Bahnen.«
»Was machen wir?«
»Einfach leise sein. Aber es ist Freitag …« Kareem redete jetzt tonlos. »Da fahren die doch die Nacht durch.«
»Nnnnnnnnnn …« Hinter ihnen im Gebüsch war ein Rascheln zu hören. »Nnnnnnnnn …«, machte es wieder.
Kareem drehte sich um und trat dem Bündel fest in die Seite. »Ng …«, machte es und hörte auf, sich zu regen.
Kareem bückte sich und überprüfte den Knebel im Mund. Seine Fußballshorts saßen bombenfest zwischen den Zähnen. Er stand wieder auf und trat noch einmal zu.
»Die Schnürsenkel halten?«, fragte Issam leise.
»Bombenfest.« Kareem hob einen Daumen, checkte trotzdem noch einmal Hände und Füße.
Die Leute waren nähergekommen. Ihre Stimmen waren deutlich vernehmbar. Kareem erkannte drei Gestalten. Drei Männer. Leicht schwankend.
»Alles piccobello sonst …«, sagte einer.
»Die Strände?« Der zweite.
Der dritte lag einige Meter zurück und blickte sich um. Suchte einen Platz im Gebüsch. Kareem tippte Issam an. Legte den Finger auf die Lippen.
»Alles in Antalya. Leute nett und höflich. Strände sauber und nicht zu voll. Und kein Mensch redet über Politik.«
»Komm schon«, sagte der zweite und drehte sich dabei um. Der dritte beschleunigte seine Schritte.
Von Osten, von der Hermannstraße, kam die nächste S-Bahn gefahren. »Zu spät«, sagte Kareem. »Guck mal. Wenn die abfährt in der Hermannstraße, das kann man ja hören. Dann gehen wir los.«
»Hmhm …« Issam drehte sich um und blickte zu dem Bündel hinab.
»Wir können es nicht austesten. Gibt keinen Probedurchgang. Bahn fährt los. Wir starten und ziehen das durch.«
»Doch. Wir können das schon einmal durchgehen. Wenn wir hören, dass die Bahn abfährt, gehen wir zum Geländer. Dann sehen wir ja, ob das mit der Zeit hinhaut. Das sind … guck … 40 Meter?«
Kareem sagte nichts.
»Der hier kann ja nicht weg. Oder?«
»Du willst gar nicht mehr.«
»Doch … Aber … Ich meine … Washington kommt jetzt bald aus dem Krankenhaus.«
Kareem schüttelte den Kopf. »Er war eine ganze Woche im Koma.«
»Ja, aber jetzt ist er bald wieder bei uns.«
»Er wird die nächsten Monate mit Schienen an den Beinen rumlaufen. Nix Fußball und so.«
»Die Ärzte haben gesagt …«
»Mann, der Typ hat Washington fast umgebracht. Hast du das vergessen?« »Nein, natürlich nicht.«
»Wir haben nicht mal gewusst, ob er das überleben wird. Am Anfang haben sie gesagt, das wird nix mehr.«
»Ja …« Issam war ganz leise geworden.
»Gleich, da, die nächste Bahn. Komm …« Kareem bückte sich und fasste die Füße des Bündels.
Als sich Issam nicht rührte, erhob er sich wieder. Die Bahn näherte sich und fuhr vorüber.
»Guck mal«, sagte Issam.
»Was?«
»Da …«
»Der Hund? Der ist gleich wieder weg.« »Das ist kein Hund.«
Kareem sah genauer hin. Vier Beine, nicht so lang, dichtes Fell, braun oder rot, spitze kleine Ohren, der Schwanz buschig. Er hatte das Tier gar nicht kommen sehen. Es guckte die eine Straße entlang, dann über die Brücke.
»Ein Fuchs«, sagte Issam. »Hab ich auf YouTube gesehen.« »Was guckst du denn auf YouTube?«
»So was eben … Alles Mögliche.«
Ein Motor wurde in der Nähe gestartet. Viel zu viel Schwung beim ersten Kontakt mit dem Gaspedal.
»Wenn sie krank sind, greifen sie sogar Menschen an«, sagte Issam. »Haben sie da gesagt. Echt interessant.«
Der Fuchs drehte den Kopf ein paar Mal und verschwand dann Richtung Tempelhofer Feld. Ohne Eile.
Kareem beobachtete die Kreuzung aus dem Gebüsch heraus. Der Motor lief weiter, ohne dass der Wagen bewegt wurde. Noch keine Scheinwerfer zu sehen.
Das Tempelhofer Feld und Grün und Laubenwirtschaft im Rücken. Wohnhäuser auf der anderen Seite, zu viele Balkone für seinen Geschmack. Die kleine Brücke über die S-Bahn-Trasse ein Teil der T-Kreuzung. Bis zum Geländer auf der Brücke 50 Meter. Vielleicht sogar nur 40, da konnte Issam Recht haben. Jetzt wurden die Scheinwerfer angestellt. Das Geräusch des Motors wurde höher. Der Wagen kam um die Ecke gerollt. Die Scheinwerfer blendeten ihn für einen Moment. Er war froh, dass sie beide dunkle Klamotten trugen.
Als der Wagen gerade um die Ecke in der Emser Straße verschwunden war, tauchte genau dort eine Figur auf, die Kareem zu erkennen glaubte. Der Typ orientierte sich kurz, checkte den Grünstreifen, in dem sie sich verborgen hielten. Er sah dann auf sein Telefon und kam zielstrebig auf sie zu.
Nach dem Fußballspiel hatte sich Emeka geduscht und zurechtgemacht. Er war es tatsächlich. Als er vor dem Gebüsch stand, in dem sie sich verborgen hatten, guckte er noch einmal aufs Telefon. »Hey«, rief er.
Kareem packte ihn und zog ihn ins Versteck. »Was ist los?«, fragte er.
»GPS«, sagte Emeka. »Ganz einfach.« Er klopfte Issam auf die Schulter.
»Ja, ist ja gut …«, sagte Issam. »Ich hab ihm ein Foto geschickt.«
»Ein Foto?«
»Hier.« Emeka reichte Kareem das Telefon. Auf dem Foto war das Bündel zu sehen. Gefesselt und mit dem Knebel im Mund. Erstaunlich, wie gut diese Fotos heute waren, dachte Kareem. Die gelbe Borussia-Dortmund-Hose war selbst im Dunkeln gut zu sehen. Sie quoll aus dem Mund von dem Arschloch raus.
»Krass«, sagte Emeka und betrachtete das echte Bündel. Den geschorenen Schädel. Die isolierten Koteletten, gerade noch im Widerschein der Straßenlaternen zu sehen. »Wo habt ihr den her?«
»Auf dem Heimweg.« Kareem. »Wir wollten eigentlich Richtung Hermannstraße. Dann haben wir ihn gesehen.«
»Er hat uns gesehen und ist auf die andere Straßenseite.« Issam.
»Nein. Er hat uns nicht gesehen. Wir sind ihm einfach nach.«
»Und dann waren wir auf einmal hinter ihm.« »Genau hier.«
»Und dann hab ich ihn ins Gebüsch gezogen.« »Ich eher …«
»Also … wir haben das zusammen gemacht.«
»Aber wer ist das?« Emeka hatte den Blick bislang nicht von dem Bündel gelassen.
»Das ist der, der Washington fast umgelegt hat«, sagte Kareem.
»Scheiße.« Emeka sah jetzt hoch. »Der ist das?«
»Hmhm …« Issam. »So sieht’s aus.«
»Jou …« Emeka holte aus und trat dem Bündel in die Seite. Hinter der gelben Hose war ein Röcheln zu hören. Emeka trat noch einmal zu. Das Röcheln wurde schwächer.
»Und jetzt?«, fragte Emeka.
Eine S-Bahn fuhr vorbei. Kareem blickte sich um und sah den Lichtern hinterher.
Emeka sagte zuerst keinen Ton. Und blies dann langsam Luft durch die Lippen. »Okay«, meinte er.
»Und jetzt, wo wir zu dritt sind, geht das viel besser. Passt auf, da kommen schon wieder Leute.«
Eine Gruppe junger Frauen näherte sich. Die letzte von ihnen, die den anderen mit etwas Abstand folgte, blieb genau auf der Höhe ihres Verstecks stehen und nahm einen langen Schluck aus einer Sektpulle. Die drei anderen waren schon ein paar Meter weiter und blieben stehen. Eine von ihnen kam zurück und nahm die Flasche in die Hand. Sie sagte irgendetwas auf Spanisch, schnell und rau, bevor sie die Flasche an den Hals setzte. Dann noch etwas. Kareem verstand nicht ganz, worum es ging. Irgendwas mit einem Job. Dann trank sie noch einen Schluck, gab die Flasche zurück und ging wieder zu den anderen. Die Nachzüglerin folgte ihr langsam. Schweigend zogen die Frauen von dannen. Zwei S-Bahnen begegneten sich unter der Brücke, als die Frauen noch zu sehen waren. In Kareems Hose brummte das Telefon, dass er dem Bündel abgenommen hatte.
»Einer nimmt die Füße.« Kareem stellte sich so, dass er die aneinander gefesselten Hände des Bündels greifen konnte. »Ich glaube, ich höre die S-Bahn schon. Kommt!«
»Da ist einer.« Emeka stand halb auf dem Gehweg und lugte zur Seite. Auf der Brücke war ein Mann stehen geblieben. Er trug eine viel zu weite graue Jacke. Kareem zog Emeka ins Gebüsch zurück. Der Mann machte ein paar Schritte, blieb stehen, blickte hoch und zur Seite. Kam wieder näher.
»Was macht der da?«, fragte Issam.
»Pssst!« Kareem legte den Finger auf die Lippen. »Nnnnnnnnnnnn …«, kam es vom Boden.
Kareem trat dem Bündel in die Seite.
»Krrr …«, machte es von unten.
Der Mann hatte die Brücke mittlerweile überquert und schaute ins erste Auto, das gegenüber dem Grünstreifen geparkt war. Ein Kombi. Checkte den nächsten Wagen, einen Golf. Sah in den daneben. Bückte sich. Ging weiter. Neben einem kleinen Sportwagen ging er in die Hocke. Im Licht einer Straßenlaterne konnte Kareem sehen, dass seine Hose einen Riss im Schritt hatte. Die Schuhe fielen beinah auseinander. Der Mann stand auf und blickte sich wieder um. Dann holte er aus und hieb mit dem Ellbogen gegen das Fenster der Fahrertür.
Nichts passierte.
Er holte etwas weiter aus und versuchte es noch einmal. Jetzt zerbrach die Scheibe.
»Scheiße!«, sagte Emeka.
Kareem wartete auf den Alarm. Aber der kam nicht.
Der Mann griff ins Auto hinein. Steckte, was er rausholte, schnell in die Jacke und ging davon. Er sah sich nicht noch einmal um.
»Wow«, sagte Issam. »Das macht der aber nicht zum ersten Mal.«
»Kann man von so was leben?«, fragte Emeka.
Eine S-Bahn passierte die Brücke von Tempelhof kommend. Eine andere gleich darauf von der Hermannstraße aus.
»Was ist jetzt?«, fragte Kareem und bückte sich.
Issam und Emeka standen neben dem Bündel.
»Okay, na gut, ich nehme die Füße«, sagte Issam.
»Ich glaub’s nicht.« Kareem stand wieder auf.
»Was?« Issam stand sofort neben ihm. »Wer ist das denn?«, fragte er, als er den Blick justiert hatte. Eine Frau kam zielgenau auf das Gebüsch zu. Sie stützte sich auf einen Gehstock. Die Schritte waren unterschiedlich lang.
»Auntie Mo«, sagte Kareem. »Hast du ihr auch das Foto geschickt?«
»Ich kenne die gar nicht.« Issam.
»Ich hab’s ihr gezeigt.« Emeka.
»Scheiße. Die hat uns gerade noch gefehlt.« Kareem drehte sich ab und starrte auf das Bündel.
Der Stock klackerte deutlich, als sich Auntie Mo näherte. Sie stand schon vor dem Gebüsch. »Wo ist er?«, fragte sie, ohne sich Mühe zu geben, ihre Stimme zu senken.
»Schsch …« Kareem blickte auf das Haus gegenüber, als die Frau durch das Gesträuch brach.
»Ist er das?«, fragte sie in derselben Lautstärke. Dann spuckte sie auf ihn. Sie holte mit dem Stock aus, überlegte es sich aber anderes, bevor er auf dem Bündel niederging.
Kareem atmete aus. »Lass uns bitte leise sein, Auntie.« »Sie ist die Tante von Washington«, sagte Emeka zu Issam. »I am not«, sagte Auntie Mo, immer noch in voller Lautstärke. »I happen to know him from Lagos.«
»Okay.« Kareem legte Auntie Mo die freie Hand auf die Schulter. »Keine Tante. Aber wir müssen leise sein.«
Ein stotternder Motor kam langsam näher. Zu niedriger Gang, Aussetzer, wieder der Motor, erneut ein Aussetzer. In dem alten Toyota waren die Scheiben herabgelassen. Kareem machte ein leises »Sssss!« Sofort waren alle ganz ruhig.
Vier junge Männer saßen in dem Wagen. Glotzten in die Gegend. Einer war eine Glatze, die anderen sahen aus wie alle. Der Wagen war hellgrün, hatte aber rostbraune Türen. Das Dach war eingedellt. Ganz kurz stockte der Motor wieder, als der Wagen den Busch passierte. Der Fahrer blickte in den Fußraum unter sich und gab dem Gaspedal unter vollem Körpereinsatz ein paar Tritte. Der Motor hustete und fing sich dann wieder. Die vier fuhren schweigend um die Ecke.
Eine S-Bahn kam von der Hermannstraße angefahren. Dann eine aus der anderen Richtung. Kareem sah sich um. Die anderen machten keine Anstalten, ihm zu helfen. Issam schaute auf die Straße. Emeka war mit sich selbst beschäftigt. Auntie Mo blickte nach unten. Sie schüttelte den Kopf. Der Arm mit dem Stock zuckte.
»Wir können das jetzt ganz schnell machen«, sagte Kareem. »Zu viert geht das ganz einfach.«
Emeka bückte sich, Issam drehte sich zu dem Bündel. »Ich kann das nicht«, sagte Auntie Mo. »Mein Bein.«
Laufende Schritte, die näherkamen.
»Nnnnnnnnnnn …«, kam es vom Boden. Die vier Stehenden wandten sich der Straße zu.
»Nnnnnnnnnnn …«
Die Schritte waren jetzt deutlicher hören. Schnell und leicht. Keine Sneakers.
Eine S-Bahn übertönte die Laufgeräusche. Als die S-Bahn verklungen war, tauchte die Gestalt aus der Emser Straße kommend auf.
»Fuck me«, sagte Kareem. »Wo kommt die denn jetzt her?«
»Tanja.« Emeka schien weniger überrascht. »Das Foto?«, fragte Kareem.
»Ja … Sie auch.«
»Wo seid ihr?«, rief Tanja.
»Komm.« Emeka hielt eine Hand aus dem Gebüsch heraus. Tanja sprang durch die Lücke, die er mit dem Arm schuf.
»Die sind hinter mir her.« Tanja war außer Atem. »Wer?«
»So … Rechte … Nazis …« Tanja atmete aus. »Ein ganzer Wagen voll.«
»Mist«, sagte Issam.
»Haben angehalten. Und … Kacke geredet. Das war voll unangenehm.«
Kareem wollte wissen, was sie gesagt hatten, wollte aber nicht fragen.
»Das ist er?« Tanja hatte wieder Luft und zeigte nach unten.
»Hmhm«, sagte Kareem. »Die Narbe.«
Sie bückte sich und verteilte eine Reihe von Backpfeifen. »Hnnn …«, kam es vom Bündel.
Tanja schlug weiter, bis sie erneut außer Atem war. »Hnnn … hnnn … hnnn…«
»Komm«, sagte Emeka und nahm Tanja in den Arm.
»Reicht.«
»Und die Nazis?«
»Sind mir nicht hinterher.«
Der stotternde Motor war fern wieder zu hören. Kam näher. Jetzt war auch Rockmusik im Spiel. Sie wurde gleichzeitig mit den Motorgeräuschen lauter.
»Arschlöcher.« Kareem wartete darauf, dass der Wagen auftauchte. »Wir könnten einfach rausgehen und sie alle zusammenschlagen.«
»Bist du bescheuert?« Tanja war jetzt ganz laut. »Die sind bestimmt bewaffnet.«
Der Wagen tauchte wieder auf. Er kam aus der Emser Straße und blieb vor dem Gebüsch stehen, in dem sie verborgen waren. Der Fahrer stellte die Musik aus und öffnete die Tür. Er stieg aus und schaute die Straße erst in die eine, dann in die andere Richtungen hinunter. »Die muss doch irgendwo sein«, sagte er.
»Oder sie wohnt hier«, rief jemand aus dem Auto.
»Komm.« Noch eine andere Stimme. »Wir haben zu tun. Wir suchen doch den Björn.«
Der Fahrer setzte sich in den Wagen, stellte die Musik wieder an. Es war fürchterlicher Krach. Neben sich hörte Kareem jemanden kichern.
Hinter einem Balkon auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging das Licht an. Zweiter Stock. Ein großer Mann trat heraus und sah auf die Straße. Er stellte sich an die Brüstung und zündete sich eine Zigarette an. Die vier Män- ner fuhren davon. Der auf dem Balkon beugte sich so über die Brüstung, dass er dem Auto nachsehen konnte.
»Ganz leise jetzt«, sagte Issam.
»Hnnnnnnnn!«, machte das Bündel. Kareem trat nach hinten aus.
In der gleichen Etage ging ein weiteres Licht an. Ein anderer Mann kam heraus. Auch er zündete sich eine Zigarette an. Die beiden Männer blickten sich nicht an. Kein Wort fiel zwischen ihnen. Als der erste zu Ende geraucht hatte, schnippte er die Kippe nach unten und zog sich zurück. Der andere tat es ihm kurz darauf gleich und verschwand auch.
Emeka hielt Tanja immer noch im Arm, als sich Kareem umdrehte. Er sah, wie sie sich befreite und mit dem Absatz genau in die Mitte des Bündels trat.
»Iiiiiirrr …«, kam es hinter der Borussia-Hose hervor. »Iiiiiirrr …«
Er wusste, dass der Verschnürte ein Nazi war, aber Kareem tat es beim Zusahen weh. Instinktiv zog er die Hoden ein.
Tanja trat noch einmal zu und dann noch einmal. Das Bündel krümmte sich, so gut es ging. Kareem zog sie weg.
Sie blies vor Wut. »Am Anfang haben sie gesagt, dass Washington nie wieder einen hochkriegt. So sehr haben sie ihn getreten. Da lag er ja schon am Boden. Und …«
»Wie viele waren die denn?«, fragte Issam.
»Drei. Der eine hat mich festgehalten. Und die anderen haben Washington verprügelt. Und als er am Boden lag haben sie ihn zuerst gegen den Kopf getreten. Und dann … Es war so schrecklich. Der war das.«
»Und dann?«, fragte Issam.
»Der, der mich festgehalten hat, der hat mir eine geschallert. Ganz fest. Aber ich hab das gar nicht gemerkt. Ich hab nur Washington gesehen. Dann sind sie weg.«
Eine S-Bahn passierte die Brücke von Tempelhof kommend.
»Jetzt?«, fragte Kareem und ließ Tanja los.
Issam griff sich die Füße. Tanja griff unter die Knie. Kareem bückte sich und wartete auf Emeka. Auntie Mo stand dabei und sagte kein Wort. Das Bündel wand sich. Vor Schmerz oder um sich zu wehren.
»Bestimmt kommt bald eine«, sagte Tanja.
»Beeilung«, sagte Issam.
»Kommt«, sagte Emeka.
Als sie ihn sicher im Griff hatten, erlahmte der Widerstand des Bündels etwas. Kareem überprüfte, ob die Straße frei war. »Also«, sagte er.
Sie stürzten aus dem Gebüsch und gingen eilig zur Brücke. Der Typ war mager und leicht.
An der Hermannstraße wartete eine S-Bahn auf die Weiterfahrt. Sie konnten die Scheinwerfer sehen. Ganz leise war die Ansage zu hören. Das Bündel begann, sich zusammenzuziehen. Die Türen der Bahn würden sich jetzt schließen. Sie hatten ihn immer noch fest im Griff, als die S-Bahn losfuhr.
»Wir müssen ihn aufs Geländer legen«, sagte Emeka.
»Mit Schwung dann.« Kareem war der Zug schon viel zu nah. Jetzt mussten sie sich beeilen. »Auf drei«, sagte er. »Eins …«
»Zwei …«, sagte Issam.
»Halt«, rief Tanja. »Das ist er nicht.«
Alle ließen zur gleichen Zeit los. Das Bündel knallte gegen das Geländer und fiel dann vor ihnen auf den Fußweg. Die S-Bahn rauschte unter ihnen hindurch.
»Was heißt: Das ist er nicht?« Emeka stand direkt vor Tanja. Auntie Mo schüttelte den Kopf.
»Da«, sagte Kareem. Er zeigte auf das Gesicht. »Die Narbe.«
»Sie ist auf der falschen Seite.«
»Wie falsche Seite?«
»Die falsche Seite.«
Alle beugten sich über das Bündel.
»Da …«, sagte Tanja. Sie fuhr die Narbe unter dem rechten Auge nach. Kurz und dick gab sie dem Auge den Anschein, als würde es leicht schräg zu dem anderen liegen.
»Die muss da sein«, sagte Tanja. Sie zeigte auf die linke Wange. »Von hier …« Das war direkt neben dem Auge. »Bis da …« Das war fast am Mundwinkel. »Ganz anders.«
»You sure?«, fragte Auntie Mo.
»Ja. Absolut. Er hat mich immer wieder so angegrinst, als er Washington zwischen die Beine getreten hat. Das vergisst man ja nicht.«
Alle richteten sich wieder auf.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Issam.
Schweigen. Eine S-Bahn kam aus Tempelhof.
»Nazi ist er auf jeden Fall«, sagte Emeka. »Keine Frage.« »Hast du denn die beiden anderen gesehen«, fragte Kareem.
»Den einen gar nicht. Den, der mich festgehalten hat. Und den anderen nicht richtig.«
»And these guys in the car?«, fragte Auntie Mo.
»Keine Ahnung. Die konnte man ja nicht erkennen.« »Wisst ihr was?« Issam hielt den Zeigefinger hoch. »Wir lassen ihn hier liegen. Dann kommt die Polizei und findet ihn. Der hat bestimmt einen Haftbefehl offen …«
»Wenn die Polizei das überhaupt mal interessiert?«, sagte Kareem. »Aber okay …« Er dachte nach. »Schillerkiez? Ein letztes Bier?«
Alle setzten sich in Bewegung. An der Kreuzung, ganz in der Nähe vom Gebüsch, wo sie sich versteckt hatten, fiel Kareem noch etwas ein. Er ging zurück zu dem Bündel.
Als er sich über den Jungen beugte, weiteten sich dessen Augen. Er hatte immer noch Angst. Kareem zog ihm die Borussia-Dortmund-Hose aus dem Mund.
Die Augen des Jungen wurden schmaler. Kareem sah, wie er die Muskeln um seinen Mund herum anspannte. »Kanacke«, sagte der Junge heiser.
Kareem holte das Telefon des Nazis aus der Hosentasche. Er warf es auf die Gleise, als an der Hermannstraße eine S-Bahn startete. Dann drehte er sich um und ging den ande- ren hinterher. Er freute sich auf das Bier.
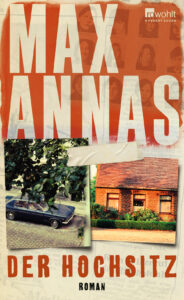
Max Annas, geboren 1963, arbeitete lange als Journalist, lebte in Südafrika und wurde für seine Romane «Die Farm» (2014), «Die Mauer» (2016), «Finsterwalde» (2018) und «Morduntersuchungskommission» (2019) sowie zuletzt «Morduntersuchungskommission: Der Fall Melchior Nikolai» (2020) fünfmal mit dem Deutschen Krimipreisausgezeichnet. Bei Rowohlt erschien ausserdem «Illegal» (2017).
Rezension mit Interview von «Der Hochsitz» auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © Max Annas




 Peter Henisch, geboren 1943 in Wien. Nachkriegskindheit, Wiederaufbaupubertät. Studium der Philosophie und Psychologie. 1969 gemeinsam mit Helmut Zenker Begründung der Zeitschrift «Wespennest». Seit den 1970ern freischwebender Schriftsteller. 1975 erschien Henischs erster Roman «Die kleine Figur meines Vaters», seitdem zahlreiche Romane. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Österreichischen Kunstpreis.
Peter Henisch, geboren 1943 in Wien. Nachkriegskindheit, Wiederaufbaupubertät. Studium der Philosophie und Psychologie. 1969 gemeinsam mit Helmut Zenker Begründung der Zeitschrift «Wespennest». Seit den 1970ern freischwebender Schriftsteller. 1975 erschien Henischs erster Roman «Die kleine Figur meines Vaters», seitdem zahlreiche Romane. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Österreichischen Kunstpreis. 




 Nur weg, egal wohin! Hauptsache raus aus dem Dorf. Wie so viele junge Leute zieht es Valentin Moritz aus der Enge seiner südbadischen Heimat in die Ferne. Nach Stationen rund um den Globus landet er in Berlin. Neukölln und Niederdossenbach – dazwischen liegen Welten. Der Kontakt zur Heimat – eher sporadisch.
Nur weg, egal wohin! Hauptsache raus aus dem Dorf. Wie so viele junge Leute zieht es Valentin Moritz aus der Enge seiner südbadischen Heimat in die Ferne. Nach Stationen rund um den Globus landet er in Berlin. Neukölln und Niederdossenbach – dazwischen liegen Welten. Der Kontakt zur Heimat – eher sporadisch.




 Lea Catrina ist Autorin und Texterin. Sie hat Multimedia Production in Chur sowie Literarisches Schreiben in Zürich studiert. Zudem ist sie seit 2019 Mitglied des Literaturkollektivs «Jetzt». Catrina ist in Flims aufgewachsen, lebt heute in Zürich und verbringt einen Teil des Jahres in der San Francisco Bay Area. Beim Arisverlag ist ihre Roman «Die Schnelligkeit der Dämmerung» erschienen.
Lea Catrina ist Autorin und Texterin. Sie hat Multimedia Production in Chur sowie Literarisches Schreiben in Zürich studiert. Zudem ist sie seit 2019 Mitglied des Literaturkollektivs «Jetzt». Catrina ist in Flims aufgewachsen, lebt heute in Zürich und verbringt einen Teil des Jahres in der San Francisco Bay Area. Beim Arisverlag ist ihre Roman «Die Schnelligkeit der Dämmerung» erschienen.
 2018 und 2019 verbrachte Johanna Lier mehrere Monate in Griechenland und auf der Insel Lesbos und kam eher zufällig ins Registrierung- und Ausschaffungszentrum Moria. Eine Gewalterfahrung, die eine Antwort erforderte. Die Autorin kehrte nach Moria Camp zurück und begann, basierend auf Kriterien aus James Baldwins Essay «Everybodys Protest Novel», zu recherchieren und zu schreiben.
2018 und 2019 verbrachte Johanna Lier mehrere Monate in Griechenland und auf der Insel Lesbos und kam eher zufällig ins Registrierung- und Ausschaffungszentrum Moria. Eine Gewalterfahrung, die eine Antwort erforderte. Die Autorin kehrte nach Moria Camp zurück und begann, basierend auf Kriterien aus James Baldwins Essay «Everybodys Protest Novel», zu recherchieren und zu schreiben.