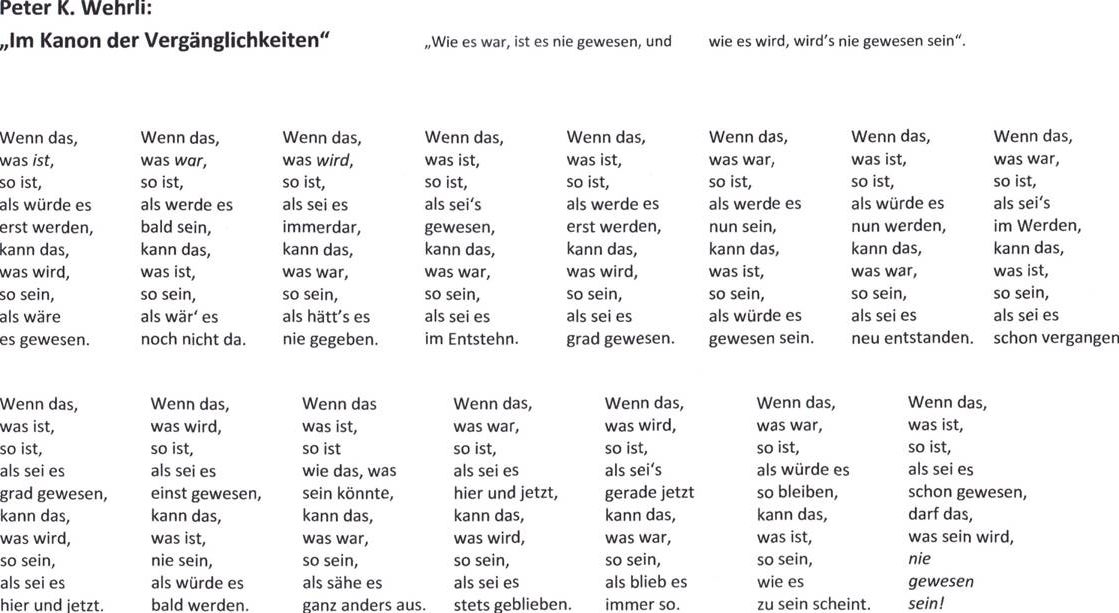
Katalog der besonderen und der andern Dinge
29 Nummern aus dem „Katalog von Allem“
1. das Klima
der Grenzübertritt von Portugal nach China, der durch die triumphbogenpathetische „Porta do Cerco“ in Macao führt, dorthin wo wirklich alles anders ist, sogar das Klima, das die Grenzpolizisten verbreiten, so anders, dass ich mir eingestehen muss: „Mehr als hier hat sich mir noch nie mit einem einzigen Schritt verändert“.
2. das Gedicht
die Liebe zur Stadt Macao, die der Dichter Austin Coates dadurch zeigte, dass er oben an der Avenida da Amizade seinen Füllfederhalter mit dem Wasser des Perlflusses füllte, damit sein Gedicht schrieb und sich dann doch darüber wunderte, dass niemand – ausser ihm – erkennen konnte, wie gut dieses Gedicht über Macao war und wie sehr er Macao liebte.
3. das Vergessen
die Antwort, mit der Anton Bruhin, als er tat, was er erklärtermassen nicht tun wollte, sein Tun begründete: «Ich habe vergessen, es nicht zu tun».
4. der Greis
die Bestürzung, mit der Dagmar von ihrem Interview mit James Stewart zurückkam, und die deshalb anhielt, weil sie nicht den strahlenden Leinwandhelden gesprochen hatte, den wir alle vor unserem Auge haben, sondern einen gebrechlichen Alten, der nur, wo er sagte, was die Journalistin bereits über ihn wusste, zu erkennen zu geben vermochte, dass er James Stewart ist.
5. das Schlimmste
…wie er das Schlimmste und das Angenehmste beschreiben würde, das er sich vorstellen könne, diese Prüfungsfrage im Kurs „Kreatives Schreiben“, die Manfed sofort, als hätte er die Frage schon gekannt, mit dem Satz beantwortete, der in den Mitschülern Schauder und Beklemmung gleichzeitig auslöste: „Es krachte, als hätte der Mond die Sonne gerammt, und das Meer, die Meere schwappten über ihren Horizont“,
5a. und die eher verstört geflüsterte Nachfrage des Dozenten:“… und das Angenehmste ?“, auf die Manred nach sehr kurzer Besinnung brüsk entgegnete: „ … dass dies alles ein Traum gewesen ist“.
6. die Clowngesichter
die in Fetzen zerfledderten Clowngesichter auf den verwitterten Plakaten des ‘Circo Americano’, die mir klar machen, dass in der Schweiz die Anschläge von den Wänden entfernt werden sobald der Zirkus weitergezogen ist, dass sie in Brasilien aber erst dann nicht mehr sichtbar sind, wenn sie die Sonne ausgebleicht, der Regen verwaschen und der Wind zerzaust hat.
7. die Sympathie
die Sympathie, die ich für den Detektiv Marlowe empfinde, und dies allein deshalb, weil ihn Osvaldo Soriano im Roman «Traurig, einsam und endgültig» in einem Anflug von ergreifender Selbsterkenntnis sagen lässt: «Ich habe mein Leben lang gefragt und habe darüber vergessen, wie man antwortet».
8. die Zeit
die Feststellung, dass man von Germain Nouveau nicht etwa deshalb nicht mehr spricht und die Grossartigkeit des Monsu Desiderio nicht etwa deshalb vergessen worden ist, weil das, was die beiden taten, zwecklos gewesen wäre, sondern ganz einfach nur deshalb, weil die Zeit das grossmaschigste aller Siebe ist, – und offenbar nur selten jemand das Herstellen von feinmaschigeren für sinnvoll hält.
9. die Speisekarte
die Speisekarte im Restaurant „Ribouldingue“ (10, rue Saint Julien le Pauve, 75005 Paris), die mich irritiert, dann verstört und mich schliesslich anekelt weil da als Gerichte nur Innereien angepriesen werden: Nieren, Lebern, Milz, Hoden, Hirn, Lunge, Herz, Kutteln etc., und meine Vermutung, dass ich Pablo, der mich eingeladen hatte, nur dann werde vorspielen können, das bestellte Gericht schmecke mir, wenn diese Innereien auf dem Teller so angerichtet sind, dass nicht (und für niemanden ) wahrzunehmen ist, dass es Innereien sind
10. die Vergangenheit
das Gewimmer in der Sitzreihe hinter mir bei der Vorführung von Charlie Chaplins Film «Circus» im Kino in Vevey im Mai 1969, dieses sirenenartige Heulen, das sich anhörte, als schalle es über weite Ebenen und frisch vernarbte Grenzen in diesen Tag hinein, und das mir wohl nur deshalb noch jetzt in den Ohren hallt, weil mir ein Blick nach hinten verraten hatte, dass es niemand anders war, als der greise Charles Chaplin, der da vor seinem jugendlichen Abbild auf der Leinwand weinte, jammerte angesichts einer Vergangenheit, die nur die Tränen jenes Menschen weckt, dessen Zukunft schon vorbei ist.
11. die Augenmerk
Ernsts Trauer über den Verlust des Schwenks, die noch grösser ist als jene über den Verzicht auf Zooms in Fernsehsendungen, das Bedauern also, dass diese Bildbewegungen nicht mehr ausgeführt werden dürfen, weil sie – da Schauen Zeit braucht und Sehen nicht – jene Sekunden kosten, die der Zuschauer im Zeitalter des Zappens braucht für seinen Entschluss, ein anderes Programm anzuwählen,
11a. und die erst beim Wiederlesen deutlich gewordene Einsicht, dass diese Eintragung durch eine Schärfenverlagerung viel verbindlicher werden könnte, dadurch nämlich, dass der Augenmerk im Titel von ‘der Schwenk’ auf ‘das Zeitalter’ verlegt würde.
12. die Folgen
die lakonische Trockenheit im Satz: «Nur Tote sterben nie», mit dem der greise Greta Garbo-Verehrer im ‹Esquinade‹ meine Frage beantwortet hatte, wie weit sich seine Art der Verehrung mit dem Tod der Schauspielerin gewandelt habe, und meine kurz nur aufflackernden Gedanken an die möglicherweise schauerlichen Folgen seines Nachsatzes: «Bei Filmstars spielt es keine Rolle, ob sie lebendig sind oder tot.»
13. der Kapitalismus
die beim Überdenken der Interviewspielregeln aufkommende Vermutung, dass Andy Warhol einerseits die zermürbende Wiederholung vermeiden und andererseits dem Interviewer etwas Verblüffung verschaffen wollte, als er damals, in der Galerie Bischofberger, Bices Frage: «Do you like Capitalism?» mit «Ja» beantwortete, und auf die von jemand anderem kurz darauf gestellte Frage: «Do you like Communism?» ebenfalls ein «Ja» ins Mikrophon hauchte und dann, auf die Ausschliesslichkeit der einen Antwort gegenüber der andern aufmerksam gemacht, sagte: «Oh, ich habe bereits vergessen, dass ich die vorherige Frage mit ‹Ja› beantwortet hatte!».
14. die Demokratie
die fundamentale Einsicht in die Formen des menschlichen Zusammenlebens, die Rara in ihrem radikalen Leitsatz verriet, dem ich –aller Radikalität zum Trotz – meine Zustimmung schenke: „Wer für die Privatisierung von Wasser. Strom, Luft, Verkehr plädiert, hat nicht begriffen, was Demokratie ist!“
15. der Kassenzettel
meine Verlegenheit, die sogar Beklemmung war und mich zu überprüfen zwang, ob ich denn schon so gebrechlich und vergreist aussehe, dass die junge Verkäuferin im Sainsbury Grund hatte, mich zu fragen: „Sie sind sicher über achtzig ?“
15a. und die Erlösung vom Schock, den mein ungenaues Zuhören verursacht hatte, als ich zuhause dann auf dem Kassenzettel unter dem Namen des erstandenen Rotweines ‚Corbières’ den Aufdruck fand: „Die Verkäuferin bestätigt, dass der Kunde über achtzehn Jahre alt ist“.
16. der Zerfall
meine Weigerung anzuerkennen, dass die kindlichen Gesten in der Altersdemenz Zeichen des Zerfalls seien, weil Eugens Gesten von jener frischen wachen Kindlichkeit sind, die verraten, dass sich da einer – mit List und endlich mit Erfolg – in seine Kindheit zurückgelebt hat,
16a. und meine eben überprüfte Feststellung, dass ich noch nie jemandem begegnet bin, von dem ich das Umgekehrte sagen könnte, nämlich: er habe sich – mit List und endlich mit Erfolg – in sein Alter vorgelebt.
17. der Roman
sein Temperament, sein Wissen, seine Vorlieben, seine Klugheit, seinen Witz und seine Neigungen, die der Schriftsteller in jeden Roman und in jede Erzählung einspeist, und dies derart rigoros, dass zu sagen ist: „Einen besseren Freund als den Autor, den er liest, kann ein Leser nicht haben“.
18. das Bemühen
das erkennbare Bemühen, es beiden – Frauen und Männern – recht zu machen, das der Präsident der ASASTP an der Generalversammlung erkennen liess, als er seine Eröffnungsrede mit dem Begrüssungswort begann: «Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder»
18a. und mein Eingeständnis, dass mir die Unstimmigkeit erst aufgefallen war, als ein Versammlungsteilnehmer den Redner mit dem Zuruf unterbrach: «Max, jetzt hast du uns aber vergessen»,
18b. und mein Nachdenken, das mir eigentümlicherweise wie ein Nachrechnen vorkam und mir nach einer Weile klar machte, dass der Rufer recht hatte, weil nämlich die Wörter ‹Glied› und also auch ‹Mitglied› sächlichen Geschlechts sind,
18c. und mein Zögern, das mich jetzt – Wochen später – beim Eintragen dieser Wahrnehmung in den «Katalog von Allem» befällt, weil ich diese Nummer 18 mit ‹das Bemühen‹ überschreibe, wo ich ebenso gut und ebenso genau ‹die Vergeblichkeit des Bemühens› hätte schreiben können.
19. der Irrtum
die schönen blauen Augen des greisen Hans Coray, welche die Journalistin der Zeitschrift «Schöner Wohnen» in ihrem Artikel über den Designer beschrieb, diese Augen, die ein Irrtum sind, der sich nicht durch eine Richtigstellung im Blatt beseitigen lässt, ein Irrtum, auf den mich Rara, Corays Gattin, aufmerksam macht, als sie sagt: «Er hat gar keine blauen Augen, er schaut nur wie jemand, der schöne blaue Augen hat».
20. die Kunst
der verängstigte Blick in den Spiegel mit der fragenden Ahnung, um wieviel gealtert mich mein Spiegelbild wohl zeigen würde, wenn der Spiegel tatsächlich vorginge,
20a. und mein Lächeln beim Eingeständnis, dass ich mir diese verwegene Frage sicher nie stellen würde, wenn mich Franz Kafkas Feststellung nicht so beeindruckt hätte, die Kunst sei ein Spiegel, der vorgeht wie eine Uhr.
21. das Casting
der im herrlich entspannten Zustand vor dem Einschlafen praktizierte Versuch, auszuwählen, wem ich eine Rolle im Traum dieser Nacht zuteilen wolle,
21a. und die am Morgen beim Erwachen notwendige Feststellung, dass dieses Casting überraschenderweise perfekt funktioniert hat, – und zwar nicht aus esotherischen oder gar magischen Gründen, sondern nur deshalb, weil ich bei der Rollenbesetzung vor dem Schlaf an Susanne Wille und an Ady Berber gedacht hatte.
22. die Buschenschenke
der Empfang durch Peter Rosei und Christa in Radkersburg heute abend und das Beisammensitzen in der Buschenschenke (ein Wort, dessen Bedeutung ich – obschon sie mir erklärt worden ist – vergessen habe), die so intensiv waren, dass ich morgen früh wieder abreisen könnte im – andernorts sich erst nach längerem Aufenthalt einstellenden – schönen Gefühl, wirklich dort gewesen zu sein.
23. das Erstaunen
der alterslos alerte Kurt Guggenheim, als der er während den Dreharbeiten vor der Kamera stand, und der zum Greis gealterte, den ich nun im Filmbild vor mir sehe,
23a. und das von diesen unterschiedlichen Alterszuständen ein und desselben Augenblicks ausgelöste Erstaunen, dass mir meine möglicherweise havarierte Erinnerung einen andern, einen verjüngten Kurt Guggenheim zeigt; – der Sechsundachtzigjährige, der er ist, ist er nur im Film.
24. die Bedingung
das Glück, das du erstellen musst, wenn du glücklich werden willst, und die Bedingung dazu, die ist, dass du erst dann glücklich werden kannst, wenn du herausgefunden hast, was dich glücklich macht
25. der Glast
dieses jahrelang nicht mehr gebrauchte und deshalb fast schon vergessene Wort «Glast», an das mich das von Mittagshitze gesättigte Bild aus «High – Noon» erinnert, dieses Wort, das, obschon es das heisse Trockene signalisiert, mir jetzt doch die Tropen in den Körper und vor die Augen jagt, eine Vorstellung, die abzuwenden mir nicht gelingt; – sie bleibt.
26. der Federhalter
was ich fand, ohne es zu suchen: den Federhalter, mit dem ich vor 61 Jahren als Siebenjähriger bei Lehrer Redmann im Schulhaus Leimbach schreiben zu lernen begann, – nur seine Farbe Grün war in meiner Erinnerung längst erloschen,
26a. und was mich erstaunt, ist: nicht etwa der Fund und sein Nostalgiewert, sondern die Tatsache, dass er dort war, wo ich ihn vor sechs Jahrzehnten hingelegt hatte (in die rote Kartonschachtel) und dass er da war, obwohl ich ihn längst vergessen hatte und deshalb nicht verloren geglaubt haben konnte.
27. die Mühe
das blendend pralle Sonnenlicht über dem Eingang zum Friedhof der Freuden in Lissabon, dieses heisse Licht, durch das der alte Mann an Stöcken so zäh und gekrümmt vorwärtsschritt, als schleppe er nur mit Mühe seinen schwarzen Schatten am Boden hinter sich her.
28. die Poesie
das Entsetzen, das mich peinigt ob der heftig steigenden Zahl der Dinge, die ich bereits vergessen habe, und der Trost, dass ich wenigstens alle jene Dinge nicht vergessen kann, die mir Poesie geworden sind.
29. der Satz
der Satz, den mir nur die deutsche Sprache zu sagen erlaubt, und dem nichts und gar nichts mehr beigefügt werden muss, gar nichts mehr beigefügt werden kann, weil er der Satz von Allem ist: „Wenn der Anfang endlich zu Ende ist, kann der Schluss beginnen“:
Peter K. Wehrli, geboren 1939, Studium der Kunstgeschichte in Zürich und Paris. Reisen durch die Sahara und zur Piratenküste. Längere Aufenthalte in Südamerika. Redaktor beim Schweizer Fernsehen DRS. Tätigkeit als Herausgeber. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. «Zelluloid-Paradies» (1978), «Eigentlich Xurumbambo» (1992), «Katalog von Allem» (1999). Eine stark erweiterte und neu organisierte Ausgabe erschien 2008 unter dem Titel «Katalog von Allem: Vom Anfang bis zum Neubeginn» im Ammann Verlag, Zürich.
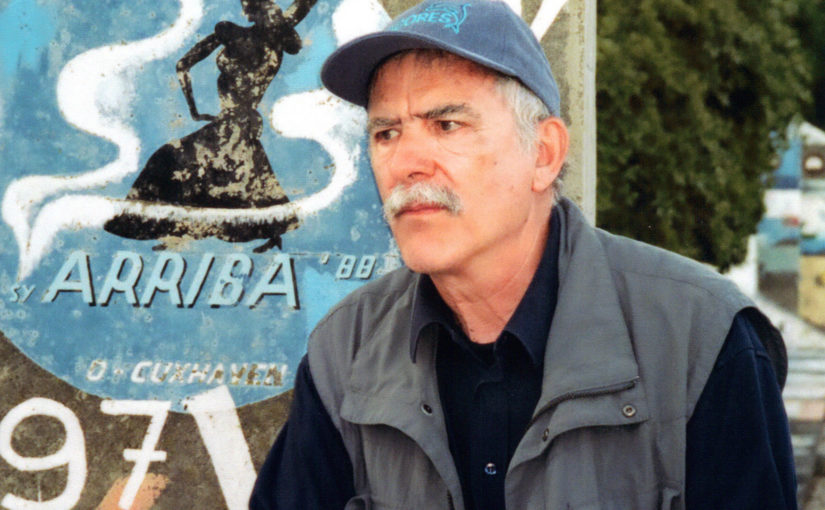



 5
5 Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.
Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.
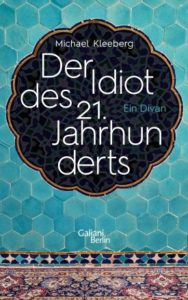 Michael Kleeberg, geboren 1959 in Stuttgart, lebt als Schriftsteller und Übersetzer (u.a. Marcel Proust, John Dos Passos, Graham Greene, Paul Bowles) in Berlin. Sein Werk (u.a. «Ein Garten im Norden», «Vaterjahre») wurde in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt. Zuletzt erhielt er den Friedrich-Hölderlin-Preis (2015), den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (2016) und hatte die Frankfurter Poetikdozentur 2017 inne.
Michael Kleeberg, geboren 1959 in Stuttgart, lebt als Schriftsteller und Übersetzer (u.a. Marcel Proust, John Dos Passos, Graham Greene, Paul Bowles) in Berlin. Sein Werk (u.a. «Ein Garten im Norden», «Vaterjahre») wurde in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt. Zuletzt erhielt er den Friedrich-Hölderlin-Preis (2015), den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (2016) und hatte die Frankfurter Poetikdozentur 2017 inne.
 Ulrich Woelk, geboren 1960, studierte Physik und Philosophie in Tübingen. Sein erster Roman, „Freigang“, erschien 1990 und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Woelk lebt als freier Schriftsteller und Dramatiker in Berlin. Seine Romane und Erzählungen sind unter anderem ins Englische, Französische, Chinesische und Polnische übersetzt. Mit seinem Roman «Der Sommer meiner Mutter» steht Ulrich Woelk auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019.
Ulrich Woelk, geboren 1960, studierte Physik und Philosophie in Tübingen. Sein erster Roman, „Freigang“, erschien 1990 und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Woelk lebt als freier Schriftsteller und Dramatiker in Berlin. Seine Romane und Erzählungen sind unter anderem ins Englische, Französische, Chinesische und Polnische übersetzt. Mit seinem Roman «Der Sommer meiner Mutter» steht Ulrich Woelk auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019.
 Romana Ganzoni wurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntag und im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.
Romana Ganzoni wurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntag und im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.
 Zoë Jenny wurde 1974 in Basel geboren. Ihr erster Roman «Das Blütenstaubzimmer» (FVA 1997) wurde in 27 Sprachen übersetzt und zum weltweiten Bestseller. In der Frankfurter Verlagsanstalt sind ihre Romane «Der Ruf des Muschelhorns» (2000) und «Das Portrait» (2007), sowie ihre Erzählungen «Spätestens morgen» (FVA 2013) erschienen. Zoë Jenny lebt heute in Breitenfurt bei Wien.
Zoë Jenny wurde 1974 in Basel geboren. Ihr erster Roman «Das Blütenstaubzimmer» (FVA 1997) wurde in 27 Sprachen übersetzt und zum weltweiten Bestseller. In der Frankfurter Verlagsanstalt sind ihre Romane «Der Ruf des Muschelhorns» (2000) und «Das Portrait» (2007), sowie ihre Erzählungen «Spätestens morgen» (FVA 2013) erschienen. Zoë Jenny lebt heute in Breitenfurt bei Wien.



 Jens Steiner, geboren 1975, studierte Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf. Sein erster Roman «Hasenleben» (2011) stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2011 und erhielt den Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung. Jens Steiner wurde 2012 mit dem Preis Das zweite Buch der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. 2013 gewann er mit «Carambole» den Schweizer Buchpreis und stand erneut auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sein letzter Roman «Mein Leben als Hoffnungsträger» erschien bei Arche.
Jens Steiner, geboren 1975, studierte Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf. Sein erster Roman «Hasenleben» (2011) stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2011 und erhielt den Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung. Jens Steiner wurde 2012 mit dem Preis Das zweite Buch der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. 2013 gewann er mit «Carambole» den Schweizer Buchpreis und stand erneut auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sein letzter Roman «Mein Leben als Hoffnungsträger» erschien bei Arche.
 Dragica Rajčić Holzner, geboren 1959 in Split (Kroatien), lebt seit 1978 in St.Gallen. Hier Gelegenheitsarbeiten als Putzfrau, Büglerin, Heimarbeiterin, Aushilfslehrerin. Verheiratet, drei Kinder. 1988-1991 Kroatien: Gründung der Zeitung «Glas Kasela»; journalistische Arbeit. Nach Kriegsausbruch Flucht mit den Kindern in die Schweiz; Öffentlichkeitsarbeit über den Krieg in Ex-Jugoslawien. Bücher: Halbgedichte einer Gastfrau, 1986 und 1994; Lebendigkeit Ihre züruck, Gedichte 1992 (vergriffen); Nur Gute kommt ins Himmel, Kurzprosa 1994 (alle eco Verlag); Theaterstücke: Ein Stück Sauberkeit, 1993; Auf Liebe seen, 2000.
Dragica Rajčić Holzner, geboren 1959 in Split (Kroatien), lebt seit 1978 in St.Gallen. Hier Gelegenheitsarbeiten als Putzfrau, Büglerin, Heimarbeiterin, Aushilfslehrerin. Verheiratet, drei Kinder. 1988-1991 Kroatien: Gründung der Zeitung «Glas Kasela»; journalistische Arbeit. Nach Kriegsausbruch Flucht mit den Kindern in die Schweiz; Öffentlichkeitsarbeit über den Krieg in Ex-Jugoslawien. Bücher: Halbgedichte einer Gastfrau, 1986 und 1994; Lebendigkeit Ihre züruck, Gedichte 1992 (vergriffen); Nur Gute kommt ins Himmel, Kurzprosa 1994 (alle eco Verlag); Theaterstücke: Ein Stück Sauberkeit, 1993; Auf Liebe seen, 2000.