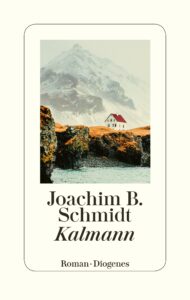Sie kam zu spät, die anderen hatten schon mit dem Essen begonnen. Es war nur noch ein Platz frei, zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn die Frau lächelte, wirkte es, als würde sie eine Übung durchführen, deren Ablauf sie beherrschte, an deren Sinn sie aber zweifelte. Der Mann war zierlich mit strähnig blondem Kinderhaar und schnurgeradem Scheitel. Auf dem Tisch standen große Schüsseln mit Miesmuscheln, jemand füllte ihren Teller, ein anderer ihr Glas. „Entschuldigung“, sagte sie nochmals, aber außer dem Mann neben ihr schien es niemand zu hören. Er sagte, „angenommen“, und hob sein Weinglas. „Pavel.“ „Mona“, sagte sie. Dann tranken sie.
Es ging um Politik, den Flüchtlingsstrom, der sich durch Mexiko zog, eine Wanderung von zweitausend Menschen. Viertausend, korrigierte einer. Und da kommen noch mehr, versprach ein anderer.
„Da war diese Mutter“, erzählte die Frau, die Mona schräg gegenüber saß. Ein beeindruckender Afro über einem ebenmäßigen Gesicht, irgendwie kostbar, dachte Mona, wie eine dieser kunstvoll geschnitzten Holzmasken. „An einem Seil kletterte sie von der Brücke auf ein Floß, um den Grenzfluss zu überqueren. Und ihr hinterher ihre Kinder, ganz fassungslos vor Angst.“ „Habe ich auch gesehen“, warf jemand vom anderen Tischende ein. „Und dann das Interview mit ihr!“
„Ja“, sagte die Frau. „Als der Reporter zu ihr sagt: Trump schickt Militär an die Grenzen, und sie nur entgegnet: Gott hat das letzte Wort, nicht Trump.“ „Zu flüchten, ist so unvernünftig. Aber zu bleiben auch“, sagte ein Mann mit grauen, millimeterkurzen Haaren. Er trug eine dickrandige Brille, wie sie vor einigen Jahren modern gewesen war. Ein asketisches Gesicht, schmaler Clark Gable Schnurrbart. Bestimmt Künstler, tippte Mona, vielleicht bekannt. Oder verkannt. Auf jeden Fall der Älteste hier. Sie zählte lautlos die Anwesenden, mit Felix, dem Gastgeber, waren sie dreizehn. Die dreizehnte Fee, dachte sie. Die zu spät kam. Wütend, weil für sie kein goldener Teller mehr da war.
„Das ist es, was Trump nicht kapiert“, fuhr der Künstler fort. „Dass seine Härte gegen die Verzweiflung nichts ausrichten wird.“
„Ist das ein Krieg?“, fragte die Frau neben Mona. „Eine Invasion?“
„Da hat wohl jemand zu viel Fox News gesehen“, sagte Pavel verächtlich. Muscheln durchreichen. Die Weinflasche. Das Klirren der leeren Muschelschalen, als sie zurück in die Schüssel geschoben wurden. Die Teller behalten, das Besteck auch, die Spülmaschine streikt, ihr versteht?, zustimmendes Nicken, dann erhoben sich zwei, nahmen die Schüsseln mit, gingen mit Felix in die Küche, Mona hörte sie lachen.
„Pavel“, sagte sie. „Ist das tschechisch?“
„Korrekt“, sagte Pavel. „Der Kleine. Das passt doch.“
„Mona… Vielleicht von Mönch abgeleitet?“
„Und? Passt das? Lebst du mönchisch?“
„Ach je.“ Mona lachte. „Kommt vor.“
„Selbst schuld.“ Pavel klang plötzlich gelangweilt. „Du lebst nur einmal, kleine Nonne. Denk dran.“
Der nächste Gang. Kalbsfilet durchreichen. Die Schüssel mit Kartoffeln, klein und rund und gelb. Erbsen. Bohnen. Ein Sonntagsessen. Das Gespräch war inzwischen zur Kunst gewechselt. Eine Ausstellung in der Bronx. Die Kunstsammlung von König Charles dem Ersten. Tizian, Holbein, Tintoretto, you name it. An der Wand der Lebenslauf des Königs, mit 49 hingerichtet, und davor neun Kinder, von denen nur eines älter als 35 wurde.
„Wenn du in den ersten Raum kommst, ist es wie in einem Albtraum: all die weißen Männer mit ihren Halskrausen und strengen Blicken, die dich anstarren.“ Die Frau neben Mona verzog angewidert das Gesicht.
„Starrst nicht viel eher du sie an?“, fragte ein Mann, den Mona bisher noch nicht bemerkt hatte. Sie musste sich vorbeugen, um ihn zu sehen: Vollbart, braune, etwas zu eng stehende Augen, nicht viel älter als sie, achtundzwanzig vielleicht, der oberste Knopf des weißen Hemdes geschlossen, was ihm etwas Verklemmtes gab.
„Das eine schließt das andere nicht aus“, sagte die Frau. Mona schätzte sie auf Ende dreißig. Sie hatte etwas Kindliches an sich, stupsnasig im Profil. Sie stocherte in den Erbsen herum, stach dann und wann ein paar auf, ihre Stimme klang fast trotzig.
Kim Jong-Un. Der Islam. Natürlich sei der Koran nicht gewalttätiger als die Bibel. Du sprichst vom Alten Testament? Weil beim Neuen sieht das dann doch etwas anders aus. Okay, aber wer war nicht alles Christ. Truman, Reagan, Bush, Trump. Oha. Jemand erzählte von einem neuen Gesellschaftsspiel, das natürlich nicht neu war, sondern genau wie Wahrheit oder Pflicht. Das hatte Mona schon mit ihren Freundinnen gespielt. Also: Was ist für dich persönlich Erfolg? Spaß am Beruf. Die Liebe. Taxifahren in Manhattan. Wie bescheiden! Eine eigene Wohnung. Die Privatschule für die Kinder. Das war der Mann mit den grauen Haaren gewesen, offenbar der einzige mit Kindern, da niemand darauf reagierte. Das charakterlich Mieseste, was du in letzter Zeit gemacht hast. Meine Mutter ausgeladen. Einen Kollegen gemobbt – aber hey, er hatte es verdient, glaubt mir. Wählt niemand die Pflicht? Was ist die denn? Alles außer Telefonscherze! Küsse eine der anwesenden Personen. Partner ausgenommen. „Ich überleg’s mir noch“, sagte der bärtige Mann.
„Und du, was hast du Schlimmes getrieben?“, fragte Pavel leise.
Mona trank einen Schluck Wein. „Eine Freundin belogen“, sagte sie dann. „Und was ist daran schlimm?“, fragte Pavel ungläubig. „Ich lüge jeden Tag.“ Er wechselte die Tonlage, leutseliger Gesichtsausdruck: „Aber nein, Liebling, natürlich bin ich dir treu, wo denkst du hin? Meinst du etwa, dass ich in deiner Wohnung, deinem Bett…? Wie kannst du nur!“ Er zuckte mit den Schultern. „Warum muss er auch dauernd verreisen, n’est pas?“
„Bist du Schauspieler?“, fragte Mona. Sie merkte, wie sie innerlich ein Stück von ihm abrückte.
„Nein.“ Er sah sie prüfend an. „Bin ich nicht.“
Apple, Facebook, Tesla. Die Nerds sind Milliardäre geworden, und die großartige Idee vom guten Konsum verpufft. Wäre ja auch zu schön gewesen, so einfach sich und gleich noch der Welt was Gutes zu tun, indem man in einen neuen Laptop investiert oder ein Bild von seinem Lunch hochlädt. Und ist euch aufgefallen, dass wir alle gleich eingerichtet sind? Sogar dann, wenn wir die Sachen vom Flohmarkt holen, damit sie schön abgeschabt aussehen. In einer Ecke steht immer auch ein Eames Chair rum. Vielleicht müsste man aufhören zu konsumieren – hinaus ins Freie, ins abgeschiedene Leben, die Glückseligkeit an frischer Luft. Hat eigentlich jemand dieses Interview mit Sean Penn gesehen? Egal, was er gesagt hat, egal was er tut: alle reden nur über seine Raucherei und dass er auf Ambiant war. Als ob er der Einzige wäre! Als ob wir uns nicht alle aufputschen und runterholen müssten. Wer hat in der letzten Woche alles Drogen konsumiert?
„Okay“, sagte der Bärtige. „Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, jemanden zu küssen.“
Alle lachten, keiner hob die Hand, auch Mona nicht. Und der Bärtige blieb sitzen und küsste niemanden. Alles fake, dachte Mona.
„Und du bist Deutsche?“, fragte Pavel.
„Hört man das?“
„Nein. Oder vielleicht doch: ja. Aber Felix hatte dich angekündigt: seine deutsche Freundin.“ Pavel lächelte spöttisch und lieb.
„Eigentlich bin ich Amerikanerin.“ Das war immer ihr Ass im Ärmel: Eigentlich bin ich Amerikanerin. Auch wenn sie ihre Staatsangehörigkeit nur dem unwahrscheinlichen Umstand zu verdanken hatte, dass ihre Eltern ein Jahr in Houston gelebt hatten, wo ihr Vater als Ingenieur beim amerikanischen Ableger des bayrischen Mutterkonzerns arbeitete und ihre Mutter, von der texanischen Sonne belebt, unerwarteter Weise doch noch einmal schwanger geworden war. Sodass nicht ihre Tochter, die zwecks Abitur in Deutschland geblieben war, sondern sie nach ihrer Rückkehr mit einem Baby dastand. Immerhin gab es Mona jetzt die Gelegenheit, in Amerika zu studieren und sich hier wie alle anderen Studenten bis zum Hals zu verschulden.
Das erzählte sie Pavel. Nicht aber, dass sie sich immer nach Amerika gesehnt habe. Dass sie sich nie ganz heimisch gefühlt hatte in Deutschland. Das war zu albern, fast so sehr wie dieses dämliche Gesellschaftsspiel.
„Und“, sagte Pavel. „Gefällt es dir hier?“
Er hatte jetzt nichts Spöttisches mehr an sich. Schien ganz zugewandt, nur an ihr interessiert.
„Vieles“, sagte sie, „gefällt mir. Die Atmosphäre, die Uni, die anderen Studenten. Anderes verunsichert mich: ich habe den Eindruck, als könnte ich jeden Moment versagen. Manchmal fühlt es sich an, als wäre ich mitten in einem Strudel und ganz allein.“
„Das kenne ich“, sagte Pavel und Mona lächelte ihn dankbar an. Er sah nachdenklich auf seine Hände, dann sagte er: „Drogen. Mir helfen da immer Drogen.“
„Welche?“
„Ecstasy, Speed, Koks, je nachdem.“ Er zuckte mit den Schultern. „Und Sex.“ Er warf ihr einen belustigten Blick zu. „Sei nicht schockiert, kleine Nonne.“
„Keine Sorge“, erwiderte Mona. „Bin ich nicht.“
Sie nahm seinen und ihren Teller, stellte sie aufeinander, dazu die Schüssel mit den restlichen Kartoffeln und trug sie in die Küche. Der bärtige Mann stand vor dem Fenster, drehte sich kurz nach ihr um und winkte sie dann zu sich heran.
„Schau mal“, sagte er leise und nickte mit dem Kinn zum Fenster. Eine Amsel saß direkt davor auf der Fensterbank, im Schnabel einen Wurm, ihr zuckender Kopf mit dem runden schwarzen Auge.
„Ein Männchen“, flüsterte er. „Erkenn ich am gelben Schnabel.“ Die Amsel flog weg, und er sagte: „Wie schön, dass wir uns jetzt endlich kennen lernen.“
Mona wandte ihm ihr Gesicht zu, sodass sich ihre Nasen fast berührten. „Finde ich auch.“
„Wollen wir das Abspülen übernehmen?“
„Wie romantisch.“ Mona lachte leise.
„Oh, unterschätz das nicht. Die Hände im warmen Wasser, das Reiben und Polieren. Und vielleicht kommt die Amsel noch mal zu uns, vom Spülbecken aus könnten wir sie sehen. Übrigens mag ich dein Kleid, dieses schillernde Grün, du siehst darin aus wie eine Nymphe.“
„Ich bin eine“, sagte Mona. „Geboren aus Schaum, einer Muschel entstiegen.“
Er nickte. „Jetzt, wo du’s sagst.“
Er hieß Alex. Er kam aus Michigan und studierte Medizin an der Columbia. Mit dem Schwamm rieb er die Teller sauber, dann hielt er jeden unter warmes fließendes Wasser, bevor er ihn ihr gab. Schmale lange Hände, fast wie die einer Frau, sie stellte sich vor, wie er ein Skalpell hielt, wie er Körper öffnete, wie er darin herumbastelte, geschickt und sicher und unbeeindruckt.
„Nein“, sagte er. „Ich will kein Chirurg werden.“
„Sondern?“
„Frauenarzt.“
„Wie schrecklich“, sagte sie. „Diese Entzauberung, meine ich.“
„Eigentlich nicht.“ Er hielt mit dem Spülen inne und sah sie an. „Der Zauber bleibt.“
„Dann ist ja gut.“
Sie nahm den Stapel mit Tellern. „Wohin damit?“
„Kinder, Kinder, Kinder!“, rief Felix, der in die Küche kam. „Ihr seid hier doch nicht zum Arbeiten. Raus mit euch, gleich gibt’s den Nachtisch.“ Er holte eine große Glasschale mit Vanillecreme aus dem Kühlschrank.
„Nein“, sagte er streng, als Mona die Schale mitnehmen wollte. „Da müssen noch Verzierungen drauf. Kirschen, Krümel, der ganze Kram, du weißt schon. Raus jetzt mit dir.“
„Schon gut“, sagte Mona. „Ich geh ja schon.“
Im Bad sah sie sich im Spiegel an. Nur wenn sie lächelte, war sie schön. Ansonsten sah sie mürrisch aus. Auf ihrem Kleid Wassertropfen in gerader Linie, wie eine Markierung. Bevor sie die Tür öffnete, wusste sie, dass Alex davor stehen würde.
„Er will mir nicht seinen Platz überlassen“, sagte er. „Ich habe ihm fünfzig Dollar geboten, aber er weigert sich.“
„Hast du nicht ernsthaft“, sagte Mona. Sie hatte Lust, ihn zu küssen. „Doch.“ Alex nickte. „War das zu wenig?“
„Wahrscheinlich“, sagte sie und ging zu ihrem Platz.
Also, sagte Pavel, jetzt da sie sich in der Küche amüsiert und ihn hier allein gelassen habe, müsse er ihr offenbaren, dass sie etwas versäumt habe, einen Streit nämlich, und wofür, wenn nicht dafür, gehe man schließlich zu einem Abendessen. Der Streit sei entbrannt zwischen zwei Frauen. Er deutete unauffällig auf die Frau mit dem Afro und auf eine zierliche Blonde, die am anderen Ende des Tisches saß und von einem bulligen Glatzkopf fast verdeckt wurde. Sie war die Einzige, die wie eine Geschäftsfrau aussah: Bluse, Blazer, Goldkette, der akkurat geschnittene Pagenkopf. Sie sah klug aus, fand Mona, und so, als wisse sie das auch.
„Es ging um Emanzipation“, sagte Pavel. „Um sexuelle Belästigung, gleiche Bezahlung, Frauenquote – nichts Neues unter der Sonne. Das Witzige war, dass sie eigentlich einer Meinung waren und sich dann doch anfeindeten. Oh je“, unterbrach er sich. „Da kommt dein Verehrer.“
Alex hatte eine Schale in der Hand und einen Löffel. Er sagte, „ich setz mich dazu, falls das okay ist“, und Pavel sagte: „Nur zu, wackerer Kämpe, du lässt dich ja eh nicht abhalten.“
Alex holte einen Stuhl und setzte sich so neben Mona und Pavel, dass sie einen Halbkreis bildeten.
„Es ging gerade um den Streit, den ihr verpasst habt“, sagte Pavel. „Zwei Frauen, die sich wegen MeToo und all dem Scheiß anfeindeten, ganz wunderbar.“
„Warum Scheiß?“, fragte Mona.
Pavel sah sie abschätzig an. „Weil’s Scheiß ist, darum. Wir steuern auf prüde Zeiten zu, das kann ich dir verraten, meine Liebe.“
„Das sagt dir deine lange Lebenserfahrung, nicht wahr?“
Mona war auf einmal wütend, es überraschte sie beinahe selbst. Bis eben hatte sie Pavels Blasiertheit noch unterhaltsam gefunden. Wie alt war er überhaupt? Fünfunddreißig, vierzig?
„Da hast du wohl recht.“ Pavel ignorierte ihre Wut. „Und ich für meinen Teil muss sagen: wenn mich Kevin Spacey betatscht hätte, hätte ich mich nicht wirklich aufgeregt.“
„Aber darum geht’s doch gar nicht“, sagte Mona. „Ob es dir persönlich gefallen hätte oder nicht. Sondern ob du dich hättest wehren können, wenn du in einer abhängigen Position gewesen wärst.“
„Hör mal, Süße. Das ist doch ein Nehmen und Geben. Ich meine, schau dir doch die Frauen mal an, Titten und Ärsche, wohin man sieht, und das alles nur, weil sie sich Vorteile damit verschaffen wollen. Aber dann dieses ‚nur gucken, nicht anfassen‘, eiteitei, die Unschuld vom Lande plötzlich! Dabei ist das doch ein Tauschgeschäft, von alters her und so bekannt wie der Katechismus.“
„Und damit ist jede Belästigung, sogar wenn es dann eine Vergewaltigung wird, in Ordnung?“ Mona sah fassungslos von Pavel zu Alex. Alex aß seine Vanillecreme, ohne den Blick zu heben.
„Ach, Vergewaltigung.“ Pavel schnaubte spöttisch. „Wer da nicht alles vergewaltigt worden sein will.“ Mit hoher Stimme sagte er: „Also ich bin da nur so mit ins Hotelzimmer und hab mir nix dabei gedacht und plötzlich liegt der auf mir. – Merkst du nicht, was das für ein Mist ist?“
„Dann gibt’s für dich also gar keine Vergewaltigung?“
Mona sah hilfesuchend zu Alex, der ihren Blick erwiderte und kurz eine Grimasse komischer Ratlosigkeit schnitt.
„Doch“, sagte Pavel. „Klar, im Park, von irgend einem Triebtäter. Aber der Begriff wird einfach inflationär gebraucht.“
„Nein“, sagte Mona. „Nein, nein, nein.“ Sie merkte selbst, dass ihre Stimme mit jedem Nein lauter geworden war. Für einen Moment schien ihr, als verstummten die Gespräche um sie herum. Aber vielleicht kam es ihr nur so vor, weil sie ganz auf Pavel konzentriert war, und auf das, was sie sagen wollte. Pavel sah sie abwartend an, sie amüsierte ihn offensichtlich.
„Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung.“ Sie bemühte sich geduldig zu klingen – geduldig und herablassend. „Sie liegt dann vor, wenn Sex an jemandem vollzogen wird, ohne dass der- oder diejenige das will.“
„Und woher weiß man immer so genau, was der andere will?“, fragte Pavel. „Jetzt stell dich nicht dumm.“
„Wenn also beide den Sex wollen, ist er okay?“ Pavel legte die Stirn in Falten und stützte sein Kinn in die Hand. Er schien sich überwinden zu müssen, um die nächste Frage zu stellen, aber etwas in seiner Stimme – diese Naivität vielleicht: zugewandt und unschuldig -, verriet Mona, dass das ganz und gar nicht so war. „Wenn es also so ist, wie es in meinem Fall war: dass jemand mit acht Jahren das erste Mal Sex hat, mit einem Vierzigjährigen, und das ganz einfach, weil beide es gerne wollen, dann ist das okay, nicht wahr?“
„Nein“, sagte Mona.
Sie fühlte eine Kälte, die sich plötzlich in ihr ausbreitete, eine dumpfe Trostlosigkeit.
„Nein“, wiederholte sie. „Das ist nicht okay.“
„Und warum nicht?“
„Weil das Kind“, sie sprach jetzt leise, „also du, ausgenutzt wurde: weil dein Bedürfnis nach Liebe oder Zuneigung oder was auch immer sexuell ausgenutzt wurde.“
Pavel schob sein Gesicht nah an ihres und sah sie forschend an. Sie hielt seinem Blick stand, aber sie erwiderte sein Lächeln nicht. „Mehr hast du nicht zu bieten?“, fragte Pavel. „Mehr nicht als diese Küchen-Psychologie? Und was, wenn ich dir verriete, dass ich derjenige war, der ihn bedrängte? Ganz einfach, weil ich geil auf ihn war?“
Jetzt nicht weinen, dachte Mona, und dann dachte sie, dass das lächerlich war: dass sie hier saß und um diesen Pavel – um das Kind, das er gewesen war, und vielleicht auch um ihn, wie er heute war, so freundlich und grausam und falsch – trauerte. Aber sie konnte nichts dagegen tun, dass ihr Herz sich zusammenzog bei dem Gedanken daran, wie dieses Kind sich anbiederte und benutzt wurde.
„Ist ja gut“, sagte sie leise. Sie stand auf. „Du hast gewonnen.“
Sie hatte ihre Jacke vergessen, darum fror sie nun in ihrem dünnen grünen Kleid. Dem Meerjungfrauenkleid. Egal, sie würde morgen bei Felix anrufen und sich entschuldigen, dass sie einfach so gegangen war. Und irgendwann in den nächsten Wochen würde sie ihre Jacke holen gehen. Dann fiel ihr ein, dass es Duncans Jacke war, und dass sich in der Innentasche die silberne Pillendose befand, die er ihr vorsorglich überlassen hatte, bis die Prüfungen vorbei waren. „Mist“, fluchte sie, „Mist, Mist, Mist.“ Wenn sie jetzt wieder zurückging und ihre Jacke holte, würde das mehr Aufsehen erregen als ihr eiliger Aufbruch von vorhin. Und Pavel würde sie lächelnd beobachten, voll mitleidiger Verwunderung. Einen Block vor Felix’ Haus kam ihr Alex entgegen, ihre Jacke über seinem Arm.
„So bekam ich wenigstens deine Adresse raus.“ Er hielt ihr die Jacke hin und sie zog sie an und tastete nach der Pillendose.
„Okay“, sagte sie. Sie war immer noch wütend auf Alex, weil er sie nicht unterstützt hatte. Aber sie war auch froh, dass sie nicht zurück in Felix’ Wohnung musste. „Danke.“
Am Morgen strich Alex mit seinen langen, schmalen Fingern über ihre Hüfte und ihr Bein, und es nervte sie nicht: sie ließ sich weiter streicheln und küssen und drehte sich irgendwann zu ihm um. Ihr Schlafzimmer war ein Chaos, nicht nur seine und ihre Kleider lagen auf dem Boden, auch zwei Weinflaschen standen da, die sie mit Duncan geleert hatte, und eine Baseballkappe lag auf dem Stuhl, von der sie nicht mehr wusste, wem sie gehörte.
Es war alles etwas viel im Moment, aber es war auch schön: wenn, wie jetzt, die Sonne durch das Fenster fiel und Streifen von Staub in die Luft zauberte, die so breit und massiv aussahen, als könnte man sich auf sie setzen und geradewegs in den Himmel über New York reiten. Natürlich würde man fallen. Aber für einige Momente wäre es wunderbar. Man brauchte nur Mut.
2019

Annette Mingels, geboren 1971 in Köln, studierte Germanistik, Linguistik und Soziologie in Frankfurt, Köln, Bern und Fribourg. Promotion in Germanistik. Nach Stationen in der Schweiz, in Montclair (USA) und Hamburg lebt sie seit Mitte 2018 mit ihrem Mann Guido Mingels und den drei Kindern in San Francisco.
Rezension von «Dieses entsetzliche Glück» auf literaturblatt.ch
Rezension von «Was alles war» auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © Anneke Novak





 Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» (2018) ist sein erster Roman.
Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» (2018) ist sein erster Roman.